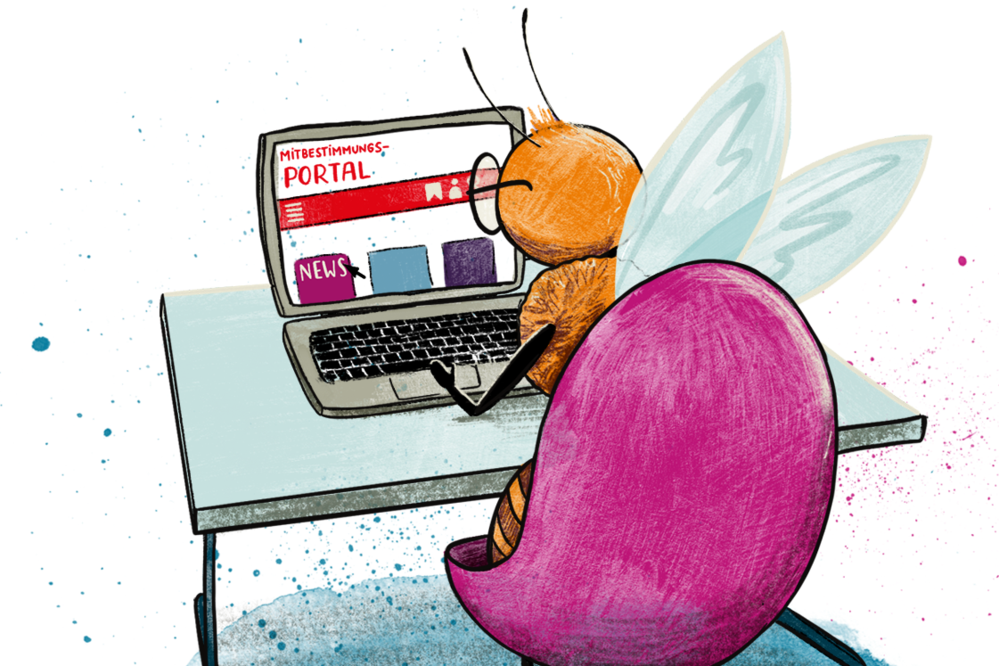Gekommen, um zu bleiben?
Fachkräfteeinwanderung und ‑integration im Gesundheitswesen
Ohne den Einsatz von Fachkräften aus dem Ausland wäre unser Gesundheitswesen bereits kollabiert. Aber an betrieblichen Integrationsmodellen, die auf langfristige Bindung setzen, mangelt es noch.
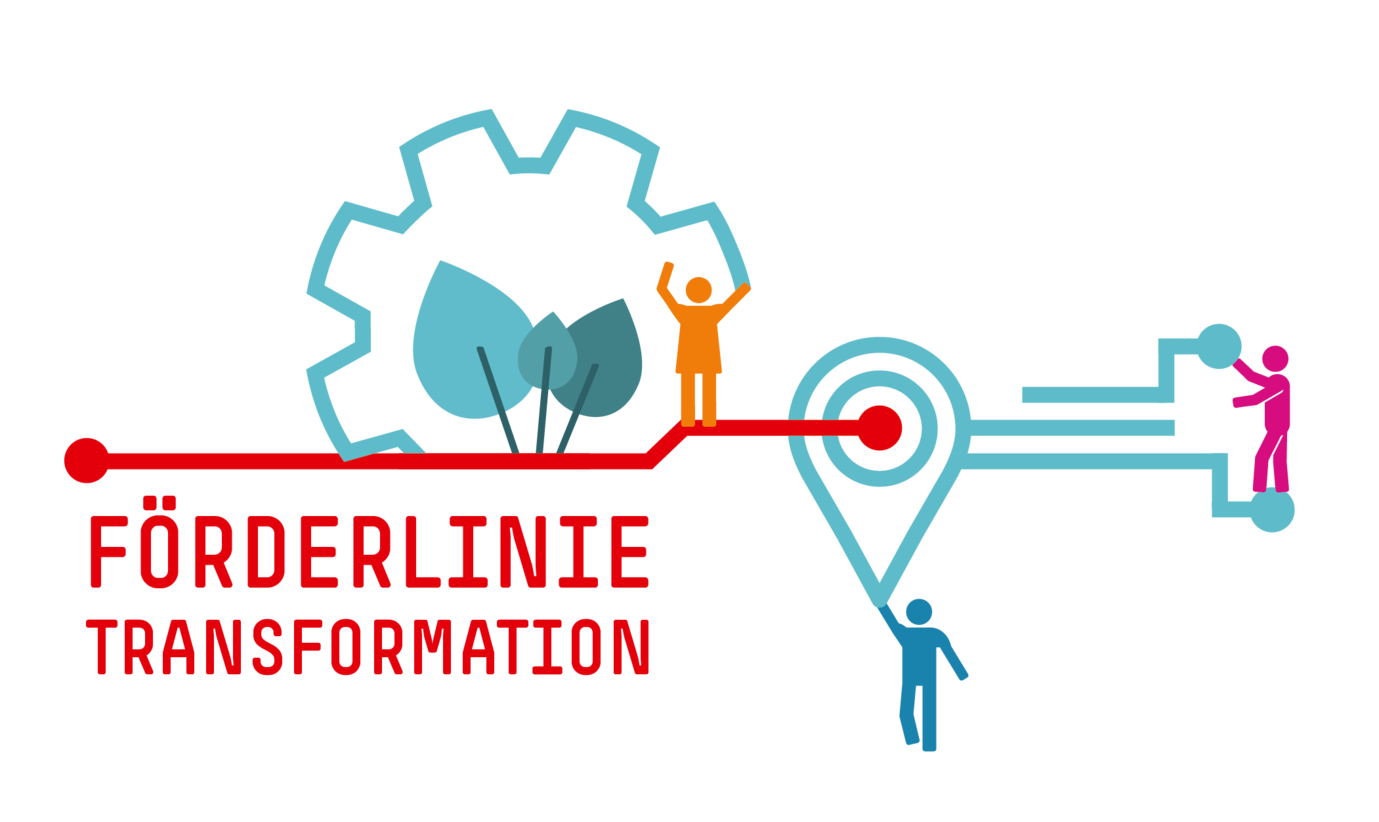
Nahezu jede fünfte Pflegekraft ist in Deutschland ausländischer Herkunft, jede vierte hat einen Migrationshintergrund, die Hälfte von ihnen ist selbst migriert. Gerade in den letzten Jahren ist der Anteil an migrierten Fachkräften im Gesundheitswesen enorm gestiegen.
Auf der einen Seite erleichtern das im November 2023 in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz und gezielte Anwerbeprogramme die Beschäftigung von Ausländern in Mangelberufen wie der Pflege. Auf der anderen Seite werden die Unternehmen zunehmend selbst aktiv, um im Ausland – teils über spezialisierte Agenturen – Pflegepersonal anzuwerben. Nicht zuletzt nutzen viele Gesundheitsfachkräfte im Ausland auch von sich aus die verbesserten Möglichkeiten, sich durch Migration oder Anwerbeprogramme neue berufliche Chancen in Deutschland zu erschließen. Häufig spielen dabei mangelnde Karrierechancen im Herkunftsland und der Wunsch, im Ausland Berufserfahrung zu sammeln, teils aber auch wirtschaftliche Not oder familiäre Erwartungen eine entscheidende Rolle, das Heimatland zu verlassen und sich auf eine unbekannte, womöglich unsichere Zukunft einzulassen.
Schon seit Jahren besteht im Gesundheitswesen ein – teils dramatischer – Fachkräftemangel. Dieser hat mehrere Ursachen. So lastet auf den Krankenhäusern und Pflegestationen aufgrund von flächendeckenden Restrukturierungsprogrammen, die nicht nur wirtschaftlich, sondern vielfach auch politisch motiviert waren und sind, ein hoher Kostendruck. Die Folge davon ist, dass ständig an der Effizienzschraube gedreht wird, was bei ausgedünnter Personaldecke immer mehr Beschäftigte an ihr persönliches Leistungslimit bringt. Dies führt vermehrt zu Personalausfällen, zu erhöhter Fluktuation und Stellenbesetzungsproblemen. Ein Weg, dem zu begegnen, ist die Anwerbung ausländischer Fachkräfte.
Pflegevorausberechnungen des Statistischen Bundesamts gehen davon aus, dass bis 2049 zwischen rund 280.000 und 690.000 Pflegekräfte fehlen werden, je nachdem, ob zusätzliche Maßnahmen zur Personalgewinnung greifen werden oder nicht. Insbesondere der demografische Wandel wird sich im gesamten Gesundheitswesen immer deutlicher spürbar auswirken. Die Generation der „Babyboomer“ kommt allmählich in die Altersphase, in der die Menschen allgemein häufiger krank sind und Pflege benötigen. Hier handelt es sich nicht nur um eine überdurchschnittlich starke Alterskohorte. Es wirkt auch der Trend einer allgemein steigenden Lebenserwartung.
Daher ist auch in den nächsten Jahr(zehnt)en mit einem starken, wenn nicht sogar zeitweilig drastisch wachsenden, Aufkommen an Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen zu rechnen. Klar ist ebenfalls, dass sich dieser steigende Bedarf nur mithilfe neuer Personalstrategien einschließlich eines systematischen Aufbaus von Personal bewältigen lässt.
Die Kliniken Südostbayern AG (KSOB) stellen sich bereits seit einiger Zeit auf diese sich zuspitzende Situation ein. Die Beschäftigung internationaler Fachkräfte wird hier inzwischen als wichtige Säule des Personalaufbaus und -erhalts betrachtet. Seit rund vier Jahren ist die KSOB AG deshalb dabei, an ihren fünf Standorten Strukturen aufzubauen, um eingewanderte Pflegekräfte schnell und zuverlässig in den betrieblichen Alltag zu integrieren. Unter anderem gibt es die Funktion eines Integrations- oder – in der Sprache der KSOB – Inklusionsbeauftragten; es gibt Onboarding-Stationen und ein Netzwerk von „Inklusions-Scouts“.
Hinter alldem steckt die Absicht, es den ausländischen Neueinsteiger*innen zu erleichtern, sich möglichst rasch in die betrieblichen Abläufe einzupassen und voll einsatzfähig zu sein – nicht zuletzt, um die restliche Belegschaft zu entlasten.
Die Kliniken Südostbayern AG (KSOB) mit ihren Standorten in Trostberg, Ruhpolding, Bad Reichenhall, Berchtesgarden, Freilassing und der Zentrale in Traunstein sind der größte Gesundheitsdienstleister der Region. Das Unternehmen betreibt seit Jahren eine Personalpolitik, zu der als feste Säule die Beschäftigung von Pflegekräften aus dem Ausland zählt. Denn allein bis 2030 werden rund 30 Prozent der 3.935 (2022) KSOB-Beschäftigten aus Altersgründen aus dem Unternehmen ausgeschieden sein.
Zu den Kernelementen ihrer Integrationspolitik (bei den Kliniken Südostbayern wird hier der Terminus „Inklusion“ verwendet) zählen strukturelle Maßnahmen – wie die organisatorische Zuständigkeit der/des Inklusionsbeauftragten und eines Netzwerks von Inklusions-Scouts – und gezielte Eingliederungsmaßnahmen, die eine enge Begleitung der internationalen Fachkräfte noch vor, aber insbesondere am Anfang ihrer Tätigkeitsaufnahme sicherstellen sollen.
Die Klinikleitung sieht allerdings konzeptionellen Beratungsbedarf insbesondere bei der Rollenklärung der verschiedenen betrieblichen Akteure, beim Kompetenzaufbau der internationalen Fachkräfte und bei der Umsetzung konkreter betrieblicher Integrationspraktiken und nahm daher aktiv an dem von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten sozialpartnerschaftlichen Projekt teil.
Nach mehreren Jahren Integrationsarbeit galt es, die Tragfähigkeit dieses Konzeptes von Integration und beruflicher Weiterentwicklung zu prüfen. In der Zusammenarbeit von Eckhard Geitz, selbst examinierter Krankenpfleger, Politikwissenschaftler und mehrere Jahre geschäftsführender Institutsleiter des Bildungsinstituts im Gesundheitswesen (BiG) in Essen, der bereits seit Jahren sowohl mit dem Betriebsrat als auch der Personalabteilung in engem Kontakt über Fragen der Personalentwicklung steht, und Andrea Müller, Geschäftsführerin des Forschungsinstituts für Arbeit, Technik und Kultur (F.A.T.K.), Tübingen, entstand die Idee, ein Modell für einen wechselseitigen und nachhaltigen Integrationsprozess zu entwickeln und zu erproben. Im Kern sollte es darum gehen, die Kompetenzen und Erfahrungen internationaler Pflegekräfte anzuerkennen und zu nutzen, um die bestehenden Pflegestrukturen innovativ weiterzuentwickeln und die langfristige Bindung der Pflegekräfte an das Unternehmen wie auch den kollegialen Zusammenhalt der gesamten Belegschaft zu stärken. Das Ziel ist eine doppelte Anerkennung internationaler Fachkräfte, um sie einerseits formal und statusbezogen und andererseits betrieblich-teambezogen und sozial in den betrieblichen Alltag einzugliedern.
Insofern sahen die betrieblichen Akteur*innen und die Wissenschaftler*innen in einem gemeinsamen Projekt im Rahmen der Förderlinie Transformation der Hans-Böckler-Stiftung, unterstützt von der Gewerkschaft Verdi, Mitte 2024 die Möglichkeit, die Stärken und Schwächen des bei den Kliniken Südostbayern praktizierten Integrationsmodells herauszuarbeiten und dieses gegebenenfalls neu zu orientieren.
Das Projekt „STAY – Gekommen, um zu bleiben? Praxisprojekt zu Fachkräfteeinwanderung und Integrationsanforderungen im Gesundheitswesen“ wurde geleitet von Hans-Jürgen Bieling, Professor am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Tübingen, und Andrea Müller. Es wurde mit einer Laufzeit von zwölf Monaten von Eckhard Geitz und Andrea Müller durchgeführt und endet mit einer Abschlussveranstaltung und einer dort erstmals präsentierten Handlungshilfe.
Der Anspruch des Projekts war von vornherein, ein Integrationsmodell zu erarbeiten, dass nicht nur die rasche Integration ausländischer Pflegekräfte in die betrieblichen Strukturen (Entgelt, Arbeitszeit, Qualifizierung) und Abläufe gewährleistet (Systemintegration), sondern auch eine umfassende Sozialintegration vorsieht. Dazu zählen unterstützende Maßnahmen zum Einstieg in die berufliche Tätigkeit bis hin zur Einbindung und Beteiligung der eingewanderten neuen Mitarbeiter*innen in den Betrieb als sozialen Ort (enge Begleitung bereits vor Aufnahme der Tätigkeit, soziale Einbindung in Teams, gleichberechtigte Teilhabe am betrieblichen Alltagsleben, Mitsprache und Partizipation usw.).
Dieser Ansatz ist die Konsequenz aus wissenschaftlichen Studien, die diverse Probleme bei der Integration internationaler Fachkräfte ausmachen. So lässt sich beobachten, dass eine nur vordergründige Eingliederung die Neuen häufig bereits nach kurzer Zeit demotiviert. Sie beeinträchtigt zugleich die Kooperationschancen und fordert oft die gesamte Belegschaft heraus. Hinzu kommt: Viele migrierte Pflegekräfte erleben nicht nur die Verfahren, die sie zur Anerkennung durchlaufen müssen, als paradox und als einen Mix aus Anerkennung und Entwertung, sondern vielfach auch die betriebliche Praxis. Denn allzu oft liegen das berufliche Selbstverständnis, Vorstellungen von Fachlichkeit, Hierarchie und Delegation zwischen neu zugewanderten und etablierten Fachkräften zum Teil weit auseinander. Die Risiken, die die Unternehmen mit der Beschäftigung internationaler Fachkräfte eingehen, um Personalengpässe zu vermeiden (nicht-adäquates Matching von Qualifikationen und Fertigkeiten, Demotivation und Konflikte in der Belegschaft, hohe Fluktuation und Exit-Bereitschaft der Neulinge oder Wechsel zu Leiharbeitsfirmen) und die auch die eingewanderten Fachkräfte eingehen, um sich neue berufliche Chancen zu eröffnen (unerfüllte Erwartungen und Enttäuschung, Überforderung, Verlassen von Familie und Freund*innen, Einsamkeit) sind beiderseits hoch. Deshalb lohnen sich größere Investitionen in eine umfassende Integration von Migrant*innen, um deren Bleibebereitschaft zu stärken.
In dem Projekt standen drei Fragen im Mittelpunkt, die es zu erkunden galt und für die innovative Lösungsansätze erarbeitet werden sollten:
- Welche Anforderungen stellen die Unternehmen, Teams und die neu migrierten Pflegekräfte an die Rahmenbedingungen guter Pflege?
- Was begünstigt neben der betrieblichen System- vor allem die Sozialintegration der eingewanderten Neuen?
- Welche Rolle spielen Mitbestimmung, betriebliche Interessenvertretung und Partizipation für die innerbetrieblichen Integrationsprozesse?
Leitidee ist ein „solidarischer Universalismus“ (Schmidt) im Sinne von guten Rahmenbedingungen, die einerseits Verschiedenheit anerkennen und andererseits allen Beschäftigten gleiche Rechte wie auch gleiche Teilhabe an den sozialen Leistungen des Unternehmens und am sozialen Leben im Betrieb sichern.
Gemeinsam lernen im Reallabor
Erkundet werden sollten die Anforderungen und betrieblichen Voraussetzungen für ein optimiertes Integrationsmodell für angeworbene Beschäftigte im Rahmen eines Reallabors, in das Management/Personalentwicklung, Betriebsrat und Beschäftigte zusammen mit den Wissenschaftler*innen eingebunden werden sollten. Bei dieser Methode geht es darum, in der gemeinsamen Interaktion experimentelle Ansätze zu erarbeiten, zu erproben und nachhaltig weiterzuentwickeln.
Auch in der praktischen Umsetzung erwies sich das Reallabor als überaus geeignete Form, verschiedene Interessenlagen und Erwartungen sichtbar zu machen und für gemeinsam identifizierte Probleme zusammen mit den Forschenden konkrete Lösungsansätze erarbeiten. Dazu wurden leitfadengestützte Interviews, Gruppendiskussionen und praxisorientierte Workshops durchgeführt.
Den Auftakt für diese gemeinsame Lernreise bildete ein Treffen der Inklusions-Scouts im Herbst 2024, in dem die Wissenschaftler*innen das Projektvorhaben vorstellten. Gemeinsam mit den Scouts erkundeten sie deren Rolle und Praxis der letzten Jahre und erarbeiteten im Sinne eines „Co-Designs“ Ansatzpunkte für das Projekt. Der gemeinsame Lernprozess endete mit einem Auswertungsworkshop Ende April 2025, in dem die im Projektverlauf gefundenen Lösungsvorschläge diskutiert und weiterentwickelt wurden.
Geeignete Strukturen als Fundament der Integration
Das Projekt profitierte davon, dass es bei den Kliniken Südostbayern bereits auf gute betriebliche Strukturen zur Integration internationaler Fachkräfte zurückgreifen konnte. Das betrifft insbesondere das Vorhandensein einer Inklusionsbeauftragten, die Etablierung von Inklusions-Scouts und eine funktionierende, lebendige Mitbestimmungspraxis, die sich nicht zuletzt in der Kooperation unterschiedlicher betrieblicher Akteure im Rahmen des Reallabors zeigte.
Von großem Vorteil war, dass sich die KSOB AG der Risiken bewusst war, die mit der Beschäftigung von internationalen Fachkräften verbunden sind, um Personalengpässe zu vermeiden und die steigenden Anforderungen bei der gesundheitlichen Versorgung bewältigen zu können. Die Integration migrierter Fachkräfte und deren Bindung an das finanziell unter Druck stehende Unternehmen sollte dauerhaft und erfolgreich gelingen. Es ging darum, auch diese Beschäftigten als wichtige Ressource für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens anzuerkennen und in deren Eingliederung sowohl Zeit als auch Geld zu investieren.
Der Personalchef selbst hatte sich teils gemeinsam mit den Pflegeleitungen aufgemacht, im Ausland die Anwerbungssituation kennenzulernen und verlässliche Agenturen zu finden. Es folgten gemeinsame Rekrutierungsgespräche, die online stattfanden. Indem er die Stabsstelle Inklusion schuf, sorgte er für eine enge Begleitung der eingewanderten Neuankömmlinge von Anfang an. Auch zeigte er sich offen für experimentelle und weitgehendere Ansätze, um deren Integration zu optimieren.
Die Inklusionsbeauftragte spielt in dem ganzen Geschehen eine zentrale Rolle. Sie organisiert Bewerbungsgespräche – zumeist per Video-Call – und führt diese zum Teil auch selbst durch, ebenso die Onboarding-Gespräche, zu denen oft auch, wenn feststeht, auf welcher Station die neue ausländische Pflegekraft eingesetzt werden soll, zumindest die Stationsleitungen geladen werden. Die Inklusionsbeauftragte ist überdies Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, Visa zu beantragen, eine Unterkunft zu besorgen oder Behördengänge zu organisieren. Ziel der KSOB AG ist es, von Anfang an eine enge Begleitung der neuen Pflegekräfte sicherzustellen. Dazu tragen auch die Pflegepädagoginnen bei, die die aus dem Ausland angeworbenen Neuen während der Vorbereitungskurse zur Kenntnisprüfung unterstützen. Weil viele der im Herkunftsland erworbenen Abschlüsse in Deutschland nicht anerkannt sind, müssen die meisten ausländischen Pflegefachkräfte ihre berufsbezogenen Kenntnisse in einer Prüfung darlegen.
Zur engen betrieblichen und sozialen Integration tragen vor allem die Inklusions-Scouts bei. Diese sind bei den Kliniken Südostbayern an allen Standorten auf den einzelnen Stationen etabliert. Sie treffen sich standortübergreifend zwei- bis dreimal im Jahr. In den Gesprächen und Interviews betonten sie mehrfach die mangelnde Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, um sich ausreichend um die eingewanderten Pflegekräfte kümmern zu können. Gerade in der Anfangszeit benötigten die Neuen jede Menge an Informationen und praktische Anleitungen vor Ort. Deshalb sei es wünschenswert, dass Scouts wenigstens zwei bis drei Tage Zeit erhielten, in der sie den neuen Kolleg*innen auf Station alles zeigen und erklären können, ohne dass erstere – wie derzeit üblich – nebenher ihr Pflegepensum vollumfänglich leisten müssen. Sonst überfordere die Situation mitunter nicht nur die internationalen Fachkräfte, sondern auch die Scouts selbst. Schließlich sei die Arbeit in der Pflege ohnehin von häufigen Zusatzbelastungen gekennzeichnet. Aufgrund ihres zusätzlichen Engagements wünschen sich die Scouts zudem mehr Wertschätzung und eine Geste der Anerkennung – etwa in Form zeitlicher Freistellungen oder extra eingeräumter bezahlter Qualifizierungszeiten, etwa zum Besuch von Fremdsprachenkursen.
Einarbeitung und Sprachkompetenz
Ebenfalls nicht einfach ist die soziale Integration der neuen Fachkräfte in die jeweiligen Pflegeteams. Auch hier kommt es mitunter zu starken Belastungssituationen bei der Einarbeitung – insbesondere in den ohnehin stressigen Pflegebereichen wie den Intensivstationen. Dies wiederum gehe oft zulasten der internationalen Fachkräfte, weil diese bei unzureichender Kompetenzentwicklung gerade am Anfang allzu häufig nur Helfertätigkeiten zugewiesen bekämen – mit dem Risiko langfristiger Folgen für die Eingruppierung in die Entgeltgruppen und die berufliche Entwicklung.
Außerdem seien es immer wieder die Gleichen, die sich um die neuen Kolleg*innen kümmerten, lautete die Kritik der Pflegeteams. Viele im Team reagierten nicht gerade begeistert, wenn jemand Neues „mitlaufe“ und eingewiesen werden müsse. „Ein Teammitglied sagte uns“, berichtet Andrea Müller, „nicht jeder wolle an fünf Tagen der Woche den Erklärbär abgeben.“ Auch den Teams sollte mehr Zeit für diese Zusatzaufgabe eingeräumt und eine größere Wertschätzung entgegengebracht werden, lautet das Fazit der Projektleiterin.
Andrea Müller, ProjektleiterinEs sind zumeist sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen, die sich kümmern, die aber auch deutlich zu verstehen geben, dass es Verbesserungsbedarf gibt.
Helfen könnte den Scouts zufolge mehr Transparenz darüber, wer wen wann begleitet. Mit eingeschlossen sind hierbei die Dienst- und Einsatzpläne, die gemeinsame Schichten der Neuen und ihrer „Kümmerer“ und die Einarbeitungsmethoden wie etwa das „Shadowing“. Beim Shadowing begleiten die Neuen die erfahrenen Mitarbeiter*innen bei ihrer Arbeit wie ein Schatten, um so in der Alltagspraxis einen Einblick in die verschiedenen Aufgaben und Abläufe zu erhalten, ohne selbst aktiv mitzuarbeiten. Nach einiger Zeit wird die Rolle umgekehrt und die erfahrene Person wird zum „Shadow“.
Die System- und Sozialintegration von internationalen Fachkräften in den Betriebsalltag ist ein wechselseitiger Prozess. Er kann nur gelingen, wenn auch die soziale Situation, die Einstellungen und Wünsche der eingewanderten Kolleg*innen berücksichtigt werden. Für die meisten von ihnen ist der Sprung weg von der Heimat und hin zu einem ihnen zunächst unbekannten Land ebenfalls mit hohen Investitionen und Unsicherheiten verbunden. Das geht aus den Gesprächen und Gruppendiskussionen mit den neuangekommenen Pflegekräften hervor.
Andrea Müller, ProjektleiterinSie lassen ihre Familien und Freundschaften zurück, müssen bürokratische Hürden bewältigen und die deutsche Sprache erlernen. Und mit den meist großen Erwartungen an ihre neue Arbeit gehen mitunter auch Enttäuschungen einher. Zum Teil wird von Abwertungserfahrungen berichtet, aber auch von tollen, unterstützenden Teams.
Insgesamt betrachtet brauche es, selbst unter günstigen Bedingungen, viel Kompetenz, Selbstbewusstsein und Willen, um die Anfänge zu überstehen. „Da muss man schon ganz schön tough sein“, so die Projektleiterin.
Die Herausforderungen beginnen mit dem Bewerbungsprozess und vor allem mit den sprachlichen Hürden. In den Interviews hat sich herausgestellt, dass manche der Neuangekommenen am Anfang nicht mehr als 20 Prozent dessen verstehen, was ihnen mitgeteilt wird. Dabei erhalten sie doch gerade zu Beginn ihrer neuen Tätigkeit eine Vielzahl an Informationen. In den Kliniken Südostbayern kommt hinzu: Personal und Patienten sprechen vielfach Dialekt. „Die neuen Kolleg*innen strengen sich an, nehmen Sprachunterricht, aber die Verständigung klappt trotzdem nicht“, berichtet die Wissenschaftlerin. Es komme mitunter zu komischen Situationen, nicht selten zu Missverständnissen, Konflikten oder fehlerhaften Abläufen – und zu Versagensängsten.
Andrea Müller, ProjektleiterinDie meisten internationalen Pflegekräfte kommen mit einem hohen Anspruch an ihre Arbeit; nicht als Bittsteller, sondern als engagierte Beschäftigte in einem Beruf, in dem sie bereit sind, einen hohen Einsatz zu erbringen und große Verantwortung zu tragen.
Viele haben sich bereits in ihren Heimatländern oder auf Plattformen für Menschen, die gerade migriert sind, darüber informiert, was sie erwartet.
Andrea Müller, ProjektleiterinUnd sie sagen ganz klar: Ich kann auch wieder zurückgehen oder in einem anderen Land arbeiten!
Aber trotz ihres Selbstbewusstseins, das auch in ihrem Selbstverständnis von Arbeit zum Ausdruck kommt, halten sich viele in Konfliktsituationen eher zurück. Das mag damit zusammenhängen, dass sie nicht „unangenehm“ auffallen wollen, zumal eine gewisse Verknüpfung zwischen Arbeitsvertrag und Aufenthaltstitel besteht. Oftmals werden jedoch auch Mitsprachemöglichkeiten nicht wahrgenommen, weil demokratische Beteiligung und die Rolle der Mitbestimmung im Betrieb schlichtweg nicht hinreichend bekannt sind.
Im Projekt zeigte sich jedoch, dass bereits mit wenigen Maßnahmen viel erreicht werden kann, um ihre Situation zu entspannen. So sind Sprachkurse von Anfang an für sie unabdingbar. Was den Dialekt betrifft, helfen mitunter Apps, um die regionale Umgangssprache besser zu verstehen. Es gab auch den Vorschlag, ein bayrisch-deutsches Glossar oder Wörterbuch speziell für Pflegekräfte zu entwickeln und die Patient*innen mit ins Boot zu nehmen, sie zu sensibilisieren und zu bitten, in der Kommunikation entweder langsamer zu sprechen oder auf Hochdeutsch umzustellen. Zwar werden die meisten Vorbereitungs- und Einführungskurse für internationale Fachkräfte online durchgeführt (und größtenteils durch die Bundesanstalt für Arbeit finanziert), ratsam ist aber, auch ein eigenes Bildungsangebot vor Ort zu entwickeln, damit die Neuen nicht nur regionale Gepflogenheiten, sondern vor allem sich untereinander besser kennenlernen. Eine Pflegepädagogin hatte die Idee, ein Café International bei der KSOB AG einzurichten – einen informellen Treffpunkt, in dem eingewanderte und andere Beschäftigte sich begegnen, näher kennenlernen, wichtige Erfahrungen oder auch hilfreiche Tipps austauschen können, um das gegenseitige Interesse aneinander zu stärken und alltägliche Solidarität praktizieren zu können.
Integration als gemeinsames Projekt der betrieblichen Akteure
Bei den Maßnahmen, die Effizienz der bereits vorhandenen Integrationsstrukturen zu verbessern und betriebliche Integrationsprozesse voranzubringen, gibt es noch viel Luft nach oben, wie sich im Projekt zeigte. Dabei ist zweifelsohne von Vorteil, dass in den Fragen von Integration und Inklusion im Grundsatz die Interessen der betrieblichen Akteure parallel laufen und somit eine gute Basis für Kooperation vorhanden ist.
Eine wesentliche Grundlage betrieblicher Integration sind Regeln, etwa auf Grundlage von Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen, die zumindest innerhalb des Unternehmens universell gültig sind.
Andrea Müller, ProjektleiterinEine Aufgabe des Betriebsrats ist es, auf das Einhalten dieser Regeln im Betrieb zu achten. Gesetze und Vereinbarungen müssen in einem Unternehmen für alle Beschäftigten gleichermaßen gelten, genauso müssen soziale Leistungen und Bildung allen zugesprochen werden.
Es gehe bei der Integration internationaler Fachkräfte im betrieblichen Alltag immer wieder darum, auf Gleichbehandlung zu achten: auf gleiche Entgeltbedingungen und berufliche Entwicklungschancen – etwa durch Teilhabe an Bildung und Förderprogrammen, um beispielsweise zu verhindern, dass sie dauerhaft in Helfertätigkeiten abgedrängt werden – und nicht zuletzt um Wertschätzung, etwa durch die Wahrnehmung und Weiterentwicklung von (in der Heimat erbrachten, aber formell hierzulande nicht anerkannten) Zusatzqualifikationen.
Betriebsräte könnten durch eigene Initiativen strukturelle Veränderungen bewirken – indem sie Zuständigkeiten wie Integrationsbeauftragte oder -Scouts einfordern oder allgemein neue Formen von Beteiligung der Beschäftigten anregen.
Nicht zuletzt brauchen eingewanderte Pflegekräfte jede Menge Ermutigung, um sich an betrieblichen Prozessen und Debatten zu beteiligen und ihr passives und aktives Wahlrecht wahrzunehmen. Wie bereits bei den Kliniken Südostbayern praktiziert, ist es wichtig, dass sich der Betriebsrat für diese Beschäftigtengruppe sichtbar präsentiert. So war dieser von Anfang an dabei, als das Unternehmen die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte zu einer wesentlichen Säule der Personalentwicklung ausbaute und beteiligt sich an Jour Fixes, bei welchen sich die betrieblichen „Integrationsakteure“ auf den neuesten Stand in Sachen Gewinnung und Inklusion internationaler Fachkräfte bringen. Der Betriebsrat nahm unter anderem an den Workshops des Projekts teil, ist bei den Einführungstagen für die Neuen mit dabei, bietet ihnen Betriebsratssprechstunden an und besucht sie auf den Stationen. Nichtsdestotrotz wird Nachbesserungsbedarf bei der Ansprache der neuen Kolleg*innen gesehen.
Andrea Müller, ProjektleiterinViele Eingewanderte kennen weder die Institutionen der Mitbestimmung noch ihre Rechte und Handlungsmöglichkeiten. Sich mit Anliegen an den Arbeitgeber zu wenden und sich beim Vorgesetzten zu beschweren, ist in ihren Herkunftsländern oft verpönt. Deshalb brauchen sie Zuspruch und Rückhalt, um ihre Rechte hierzulande wahrnehmen zu können. Der Betrieb sollte für sie nicht nur ein sozialer Ort der Begegnung, sondern auch der einer gelebten Demokratie sein – und damit ein wesentliches Fundament für ihre Integration in Arbeit und Gesellschaft.
Ansprechpersonen des Projektes
Andrea Müller, Forschungsinstitut für Arbeit, Technik und Kultur (F.A.T.K.), Eberhard-Karls-Universität, Tübingen
Eckhard Geitz
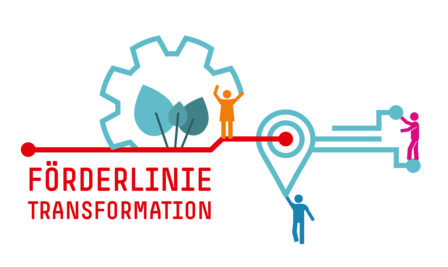
Förderlinie Transformation
Es gibt viele Treiber von Transformationsprozessen: Digitale Transformation, Klimawandel, Energiekrise etc. Folgen sind hoher Veränderungsdruck in Betrieben, Branchen und Regionen und für die dort arbeitenden Menschen. Im Zentrum der Förderlinie steht: Wir bringen Erfahrungswissen und akademisches Wissen gewinnbringend zusammen – betrieblich, regional, lösungsorientiert. Das Ziel ist, mit kurzformatigen Projekten dem hohen Veränderungsdruck in der Arbeitswelt Rechnung zu tragen. Die Veränderungsdynamiken und ihre Anforderungen an Mitbestimmungsprozesse und ihre Akteure sollen wissenschaftlich beraten und begleitet werden.