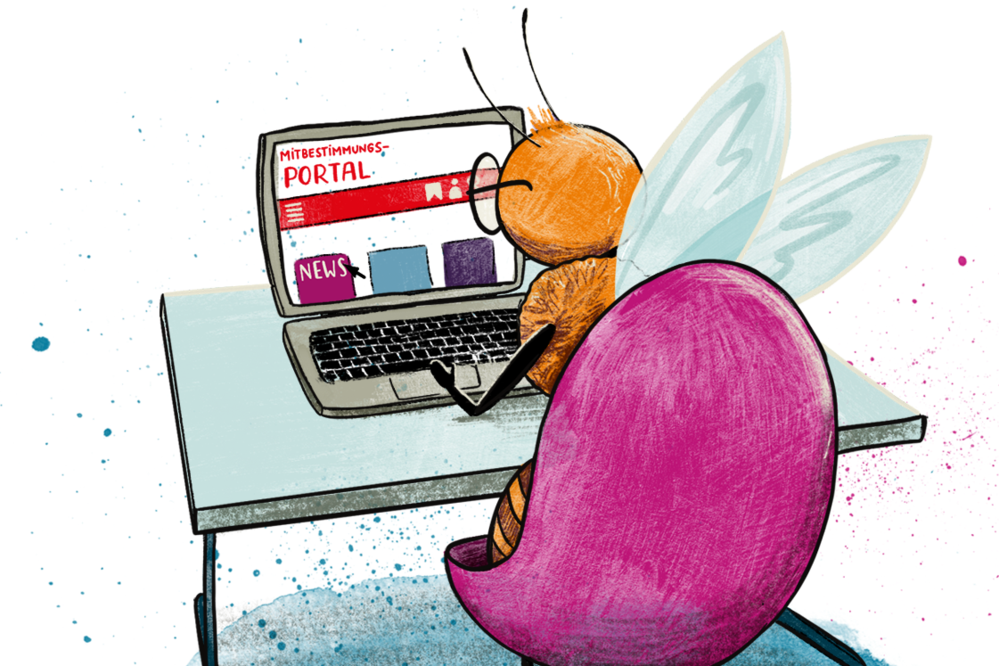Transformation und Mitbestimmung
Künstliche Intelligenz als Herausforderung für die Mitbestimmung
In die Arbeitswelt halten Systeme Einzug, die mit „künstlicher Intelligenz“ (KI) arbeiten. Betriebsräte können Einfluss darauf nehmen, wie der Einsatz dieser KI in der Arbeitswelt gestaltet wird. Doch es gibt weiteren Regelungsbedarf.
Die Idee, dass Dinge menschliche Eigenschaften, insbesondere eine Form von Intelligenz, entwickeln, hat schon lange die Phantasie von Literaten, Filmemachern, aber auch von Wissenschaftlern beflügelt. Schon die Legende vom Golem aus dem 16. Jahrhundert kann als Parabel über Künstliche Intelligenz angesehen werden: Ein Rabbi soll ein Stück Lehm zu Leben erweckt haben, um den jüdischen Bewohnern Prags zu helfen. Auch Goethes Zauberlehrling behandelt die Problematik, dass eine künstlich geschaffene Intelligenz nicht kontrollierbar ist. Später haben sich Filme wie Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“ der Materie angenommen.
Heute erleben wir, wie aus der Zukunftsvision künstlicher Intelligenz Realität wird. KI-Systeme komponieren Symphonien, übersetzen in fremde Sprachen und erkennen Krebserkrankungen. KI wird als Schlüsseltechnologie für den digitalen Kapitalismus identifiziert. Regierungen legen Förderprogramme von mehreren Milliarden Euro zur Weiterentwicklung von KI auf.
Wie bereits in den Klassikern der Literatur beschrieben, birgt Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt Chancen und Gefahren für die Interessen der Beschäftigten. Die Entwicklung zwischen den Polen der Utopie einer Arbeitswelt, in der Maschinen ungeliebte Arbeiten übernehmen, und der Dystopie von allgegenwärtiger Leistungsüberwachung und Kontrollverlust ist offen. Um das Pendel nicht in die letztgenannte Richtung ausschlagen zu lassen und den humanen Einsatz von KI-Systemen voranzutreiben, braucht es beim Einsatz von KI im Betrieb die Mitbestimmung der Beschäftigten.
In diesem Beitrag ...
... geht es um die juristischen Aspekte des Einsatzes von KI-gestützten Anwendungen im Betrieb. Bei der HansBöcklerStiftung befassen sich mehrere Forschungsprojekte mit den betriebspraktischen Implikationen von KI-Anwendungen. Diese werden im Rahmen der Forschungsförderungen durch den Forschungsverbund Digitalisierung, Mitbestimmung, gute Arbeit gebündelt. Das I.M.U. wertet bestehende Betriebsvereinbarungen aus und erläutert Praxisbeispiele (vgl. dieser Beitrag).
Begrifflichkeiten
Der Begriff der Künstlichen Intelligenz ist nicht abschließend definiert. Es handelt sich, kurz formuliert, um Informatikanwendungen, bei denen Maschinen menschenähnliches intelligentes Verhalten nachbilden. Hierfür werden große Datenmengen (Big Data) ausgewertet. Unterschieden wird „schwache KI“, die Problemlösungswissen in computergerechte Modelle und Regeln übersetzen (Sprach- und Zeichenerkennung, Navigationssysteme). Selbstlernende Systeme („starke KI“) hingegen erkennen in Datenbeständen Muster und Korrelationen, um aus ihnen neue Ergebnisse abzuleiten. Beispiele sind maschinelles Lernen und „Deep Learning“, bei dem Computersysteme ihre Fähigkeiten durch die Verknüpfung von neuen mit alten Daten stetig verbessern und so in der Lage sind, auch komplexe Probleme zu lösen.
Betriebsratsrechte
Informations- und Beratungsrechte
Der Einsatz von KI ist zwar technologisch neu, viele Lösungen des Betriebsverfassungsgesetzes lassen sich aber auf die neuen betrieblichen Wirklichkeiten übertragen. Ein Grundsatz besteht darin, dass der Betriebsrat über bevorstehende Entwicklungen frühzeitig zu informieren ist. So besteht ein Informationsrecht gemäß § 90 BetrVG über die Planung technischer Anlagen, Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze. § 92 BetrVG betrifft die Personalplanung. Generell hat der Betriebsrat einen Unterrichtungsanspruch, soweit die Information erforderlich ist, um seine gesetzlich vorgesehenen Aufgaben wahrzunehmen – und diese sind weitreichend (vgl. die Aufzählung in § 80 Abs. 1 BetrVG).
Die Unterrichtung hat unaufgefordert, umfassend und rechtzeitig zu erfolgen, damit der Betriebsrat in die Lage versetzt wird, auf unternehmerische Entscheidungen bereits im Planungsstadium Einfluss zu nehmen. Für die geplante Einführung von KI-Technologien heißt das unter anderem, dass klar werden muss, welche genauen Anforderungen an die Beschäftigten gestellt werden. An die Unterrichtung schließt sich dann die Pflicht zur Beratung an. Beides kann – nach zutreffender, wenn auch umstrittener Ansicht in der Fachliteratur – mittels einstweiliger Verfügung durchgesetzt werden: Ein Arbeitgeber kann die geplante Maßnahme so lange nicht umsetzen, wie eine ordnungsgemäße Beteiligung stattgefunden hat. Außerdem ist die Ansicht des Bundesarbeitsgerichts zu eng, wonach ein Unterrichtungsanspruch ausscheiden könnte, wenn Entscheidungen durch eine ausländische Konzernmutter getroffen werden, die nicht dem deutschen Recht unterliegt.
Betriebsratsrechte für besondere Themen
a) Beschäftigungssicherung und Qualifikation
Die Einführung von KI-Anwendung kann zum Wegfall, aber auch zur Entstehung von neuen Arbeitsplätzen führen. In jedem Fall aber kommen auf die Beschäftigten neue Anforderungen zu. Der Betriebsrat kann selbst tätig werden, um den Qualifizierungsbedarf zu eruieren. § 92a BetrVG gibt ihm das Recht, Vorschläge zu machen, um Beschäftigung zu sichern und zu fördern, wozu insbesondere die Qualifikation gehört. Um sich über die bevorstehenden Maßnahmen und Planungen sowie ihre (möglichen) Auswirkungen zu informieren, kann der Betriebsrat die Beschäftigten befragen und gemäß § 80 Abs. 3 BetrVG sachverständige Arbeitnehmer heranziehen. Stellt die Einführung der neuen Technologie – was oft übersehen wird – eine Betriebsänderung dar, so besteht zudem eine erleichterte Möglichkeit, über § 111 S. 2 BetrVG Sachverständige heranzuziehen. Für die Durchführung von Anpassungsqualifizierungen kann das Gremium nach § 97 Abs. 2 BetrVG die Initiative ergreifen. Für die Durchführung aller betrieblichen Bildungsmaßnahmen besteht ein Mitbestimmungsrecht nach § 98 BetrVG.
Natürlich wird es dem Betriebsrat auch darum gehen, auf die Sicherung der Arbeitsplätze selbst Einfluss zu nehmen. Hierfür stehen ihm nur eingeschränkte rechtliche Möglichkeiten zur Verfügung. Stellt die Einführung der KITechnologie eine Betriebsveränderung dar, kann die Beschäftigungssicherung in einem Interessenausgleich festgehalten werden, der aber nicht erzwingbar ist. Für den Sozialplan sieht das anders aus, dieser kann aber nur zum Ausgleich und zur Milderung der wirtschaftlichen Nachteile der Betriebsänderung abgeschlossen werden. Ob eine Betriebsänderung vorliegt, richtet sich nach § 111 S. 3 BetrVG, der u. a. „grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation […] oder Betriebsanlagen“ sowie die „Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren“ als Betriebsänderung qualifiziert. Ob die Schwelle zur Betriebsänderung überschritten wird, richtet sich häufig nach der Zahl der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wobei auf die Schwellenwerte des § 17 Abs. 1 KSchG zurückzugreifen ist.
b) Arbeits- und Gesundheitsschutz
Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht für betriebliche Regelungen über den Arbeits- und Gesundheitsschutz, § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG. In Verbindung mit § 5 ArbSchG sowie §§ 3 – 6 BetrSichV ergeben sich Mitbestimmungsrechte für Gefährdungsbeurteilungen der einzuführenden KI-Systeme. Zeigen sich konkrete Gesundheitsgefahren etwa durch ein erhöhtes Arbeitstempo, so können gesundheitsförderliche Maßnahmen z. B. über § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG i.V.m. § 3 ArbSchG durchgesetzt werden.
c) Beschäftigtendatenschutz
Das BetrVG gewährt dem Betriebsrat recht umfassende Rechte zur Mitgestaltung des Beschäftigtendatenschutzes im Betrieb. Nach der ständigen Rechtsprechung des BAG greift der Mitbestimmungstatbestand des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bei der technischen Erfassung oder Verarbeitung personenbeziehbarer Daten. Auf die Absicht des Arbeitgebers zur Kontrolle oder Leistungsüberwachung kommt es nicht an.
Damit unterliegt jedes Update einer mitbestimmungspflichtigen Software im Grundsatz der Mitbestimmung des Betriebsrats. Bei vielen KI-Systemen kommt hinzu, dass sich die Anwendungen selbstständig weiterentwickeln. Daraus entsteht ein neues Problem: Das Mitbestimmungsrecht ist dann bei jeder Änderung, also quasi im Millisekunden Takt, auszuüben. Damit wären die Betriebsparteien wahrscheinlich überfordert. Helfen mag es, anonymisierte Daten zu verwenden. Zudem kann – wo vorhanden – auf standardisierte Produkte zurückgegriffen werden. In einer Betriebsvereinbarung können zudem verschiedene Kategorien von ITÄnderungen gebildet werden. Die weiteren Mitbestimmungsschritte hängen dann davon ab, ob die Einführung als datenschutzrechtlich unproblematisch (z. B. bei der bloßen Beseitigung von bugs) oder erheblich (z. B. bei der Einführung einer neuen Anwendung) eingestuft wird.
d) Personalentscheidungen
Bei der Personalauswahl dürfen KI-Systeme nur eine Vorauswahl treffen, da rechtlich relevante Entscheidungen über eine Person grundsätzlich nicht ausschließlich durch eine automatisierte Verarbeitung getroffen werden dürfen (siehe Art. 22 DSGVO und Erwägungsgrund 71 zur DSGVO). Da auch KI-Systeme diskriminieren, wenn sie mit diskriminierenden Daten arbeiten, muss der Betriebsrat auf diesen Aspekt genau achten. Für die generelle Regelung des Einstellungsverfahrens kann der Betriebsrat sich auf § 95 BetrVG berufen. Er hat in großen Betrieben ein Initiativrecht. Aber auch in kleineren Betrieben hat er mitzubestimmen, wenn sich die Personalauswahl nach (geschriebenen oder ungeschriebenen) allgemeinen Auswahlregeln richtet. Verstößt der Arbeitgeber gegen die mitbestimmten Auswahlrichtlinien, so kann der Betriebsrat die Zustimmung verweigern (§§ 99, 102 BetrVG).
e) Weisungen des Arbeitgebers
Erhält ein Arbeitnehmer „Anweisungen“ von einer Software, sind diese nicht als Arbeitgeberweisung, sondern als bloße Empfehlung zu qualifizieren. Arbeitnehmer haben gemäß Art. 22 DSGVO Anspruch darauf, keinen Entscheidungen unterworfen zu werden, die ausschließlich durch ein KI-System getroffen werden.
Rechtspolitische und ethische Fragen
Ist die Betriebsverfassung für die digitalisierte Arbeitswelt gerüstet? Die Frage wird kontrovers diskutiert. Zu konstatieren ist, dass der Betrieb als gemeinsamer Arbeitsort im Zuge der Digitalisierung an Bedeutung verliert. Dass die Zahl der mitbestimmten Betriebe langsam, aber kontinuierlich sinkt, dürfte auch damit zusammenhängen. Erforderlich sind daher Vereinfachungen bei der Wahl von Betriebsräten und passende Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats für die digitalisierte Arbeitswelt.
Verschiedene Vorschläge sind darauf gerichtet, die schon bestehende Rechtslage ins BetrVG aufzunehmen. Es ist jedoch überflüssig, in § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG aufzunehmen, dass sich die Betriebsparteien auf die Berufung eines Sachverständigen einigen können. Das ist bereits jetzt möglich. Nötig wäre es vielmehr, dem Betriebsrat das Recht zu geben, falls erforderlich ohne Zustimmung des Arbeitgebers einen Sachverständigen zu berufen. Denn bis ein Gerichtsverfahren geführt ist, um die fehlende Zustimmung des Arbeitgebers zu ersetzen, hat sich die Angelegenheit meist schon lange erledigt. Auch der Vorschlag, zur Vereinfachung der Mitbestimmung Software durch ein sozialpartnerschaftliches Gremium zu zertifizieren, sollte geprüft werden. Im deutschen Recht sollte zudem klargestellt werden, dass KI-Anwendungen Arbeitgeberentscheidungen lediglich vorbereiten, nicht aber treffen dürfen. Darüber hinaus: Es bedarf eines Mitbestimmungsrechts für die Beschäftigungssicherung und Betriebsräte sollten generell für die Einführung beruflicher Weiterbildung und für Maßnahmen zum betrieblichen Datenschutz initiativ werden können. Aufgrund von Arbeitsverdichtung und -entgrenzung sollte der Betriebsrat zudem ein Mitbestimmungsrecht für die Personalbemessung und Arbeitsorganisation erhalten.
Die gesellschaftliche Debatte über ethische Fragen der Künstlichen Intelligenz ist im Sinne einer menschenzentrierten Gestaltung der Zukunft überfällig. Algorithmen bei KI-Systemen müssen verlässlich, transparent, nachvollziehbar und erklärbar sein. Diese Anforderungen müssen – ebenso wie die Anforderungen der Beschäftigten und ihrer Vertretungen – bereits bei der Programmierung berücksichtigt werden und darüber hinaus rechtsverbindlich sein. Dies gilt ebenso für den zwingenden Ausschluss von Anwendungen, die zu stark in Persönlichkeitsrechte eingreifen („rote Linien“). Auch eine Art hippokratischer Eid für Programmiererinnen und Programmierer würde dazu beitragen, die positiven Potentiale Künstlicher Intelligenz zur Geltung zu bringen und die damit verbundenen Gefahren zu vermeiden.
Perspektiven
Mitbestimmung der Zukunft
Was sind aktuelle Fragen für die Mitbestimmung? Wo liegen Herausforderungen? Wir geben Antworten aus unserer Arbeit und zeigen, was Mitbestimmung leisten kann.