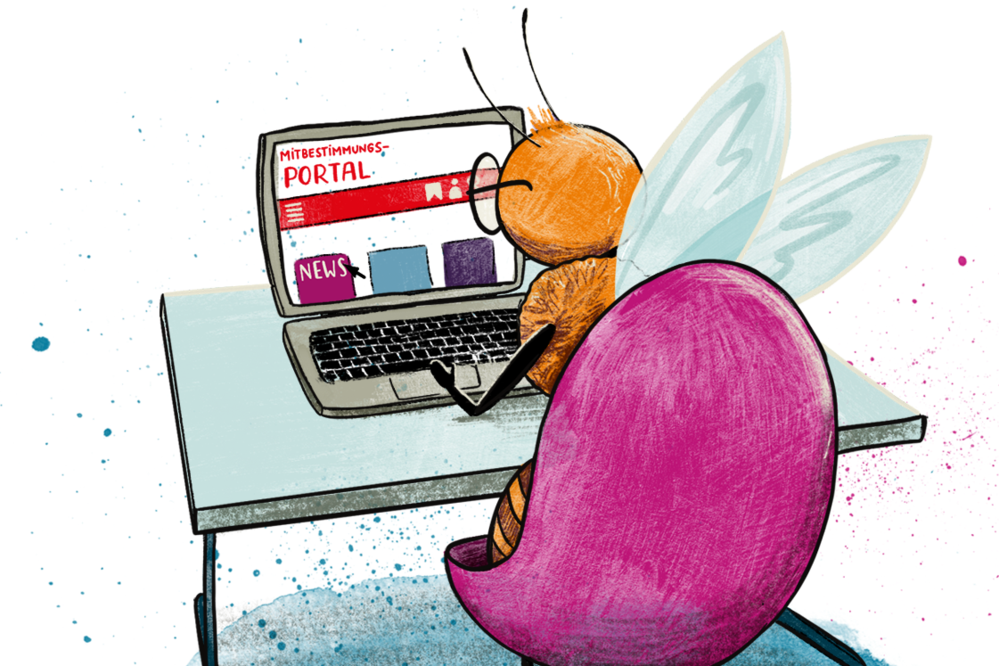Risiken identifizieren und quantifizieren
Strategisches Personalrisikomanagement bei Transformationen
Veränderungen in den Unternehmen führen oft zu negativen Folgen für die Belegschaft. Ein frühzeitiges Personalrisikomanagement könnte speziell Fachkräfteengpässe und Demotivation vermeiden helfen.
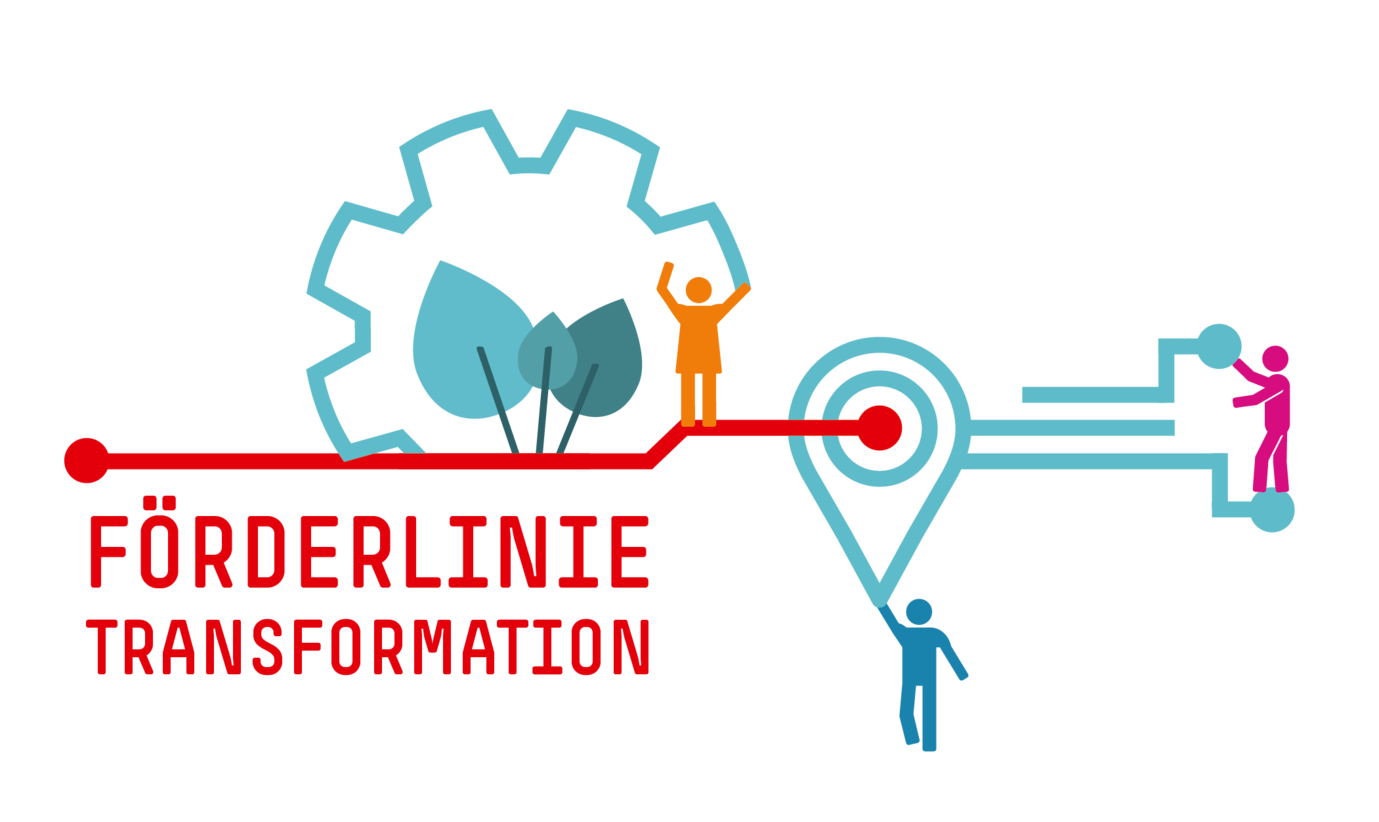
Restrukturierungen in einem Unternehmen haben zumeist zur Folge, dass Beschäftigte sich beruflich verändern müssen oder gar ihren Arbeitsplatz verlieren. Sie sind für einige von ihnen mit hohen Risiken verbunden. Dementsprechend reagieren viele verunsichert. Manche schauen sich bereits nach einem neuen Arbeitsplatz um, andere drosseln ihr berufliches Engagement, sind demotiviert.
Aber auch für Arbeitgeber sind Veränderungen im Unternehmen und beim Personal oft nicht ungefährlich. Sie müssen mit einer erhöhten Fluktuation in der Belegschaft und bei besonders von Umstrukturierungen betroffenen Beschäftigten mit „innerer“ Kündigung bis hin zu längerer psychischer Erkrankung rechnen. Unvorhergesehener Weggang oder Demotivation werden für sie vor allem dann zu einem großen Problem, wenn es sich um Schlüsselpersonen handelt, also um Mitarbeiter*innen mit speziellen Berufskenntnissen oder langer beruflicher Erfahrung. Das Problem spitzt sich zu, wenn in einzelnen Bereichen neue Prozesse – etwa durch Digitalisierung – angestoßen werden, es aber zu wenig geeignete Fachkräfte gibt, die diese neuen Aufgaben übernehmen könnten. Auch drohen Imageverluste, wenn die Verunsicherung in der Belegschaft um sich greift und das Unternehmen damit Gefahr läuft, seine Reputation als attraktiver Arbeitgeber zu verlieren.
Unternehmen, die sich in Transformationsprozessen befinden, verfügen häufig nicht über ein adäquat ausgestaltetes Personalrisikomanagement. Bei den bestehenden Systemen geht es in der Regel insbesondere darum, vulnerable Bereiche zu stabilisieren, Anpassungen vorzunehmen und Prozesse frühzeitig neu zu ordnen. Dabei wird meistens allerdings zu wenig auf die potenziellen Folgen für die Beschäftigung und die Beschäftigten selbst geachtet. Ein spezielles Personalrisikomanagement, mit dem sich Motivationsprobleme, Ausstiegsambitionen und plötzlicher Weggang gerade bei Schlüsselpersonen frühzeitig erfassen lassen, ist bislang im allgemeinen Risikomanagement eines Unternehmens in der Regel nicht vorhanden.
Diese Lücke möchte das von der Hans-Böckler-Stiftung im Rahmen der Förderlinie Transformation und von der IG Metall und der Gewerkschaft Verdi unterstützte Projekt „Transformation mit Personalrisikomanagement gestalten“ füllen. Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass ein strategisches Personalrisikomanagement dazu beitragen kann, betriebliche Mitbestimmungsakteur*innen (Arbeitnehmervertreter*innen im Betriebsrat, Aufsichtsrat, gewerkschaftliche Vertrauensleute), Vertreter*innen des Managements und sachkundige Experten im Unternehmen für Personalrisiken zu sensibilisieren, um diese frühzeitig identifizieren und gegensteuern zu können. Das gilt gerade in Zeiten, in denen sich die Herausforderungen – digitale und ökologische Transformation, Fachkräftemangel und demografischer Wandel – bündeln. Zugleich will es Personalrisiken quantifizierbar machen und Steuerungsmaßnahmen ableiten, um damit Voraussetzungen zu schaffen, diese in das allgemeine Risikomanagement eines Unternehmens einzugliedern, das zumeist auf Finanzdaten dominierten Berichten beruht.
Für das Projekt, das im Juni 2024 mit einer Laufzeit von sechs Monaten gestartet wurde, konnte Thomas Berger, Professor im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart als Projektleiter gewonnen werden. Es knüpft an ein Vorläuferprojekt von ihm an, in dem bereits ein Modell zum strategischen Personalrisikomanagement entwickelt wurde. Der Schwerpunkt bei dem hier beschriebenen Anschlussprojekt liegt auf der praktischen Umsetzung dieses Modells in drei Großunternehmen. Dazu musste es individualisiert und an die Gegebenheiten der Partnerunternehmen angepasst werden. Außerdem sollte es in deren jeweiliges allgemeines Risikomanagement integriert werden.
„Der systematische Blick auf Personalrisken fehlt bisher beim Risikomanagement von Unternehmen weitgehend. Denn es gibt, was das Personal betrifft, kaum belastbare, geschweige denn unternehmensspezifische Kennzahlen und Berichte, die im Risikomanagement genutzt werden“, berichtet Berger. In erster Linie konzentriere sich das zumeist Kennzahlen gestützte Risikomanagement bei größeren Veränderungen und Reorganisationen auf Finanzrisiken, leistungswirtschaftliche oder informationstechnische Risken. „Personalrisiken sind demgegenüber deutlich unterbelichtet.“
Das hier dargestellte Modell orientiert sich an den Risiken entlang der verschiedenen Personalmanagementtätigkeiten („Employee-Life-Cycle“) wie Personalmarketing/-auswahl, Personalbetreuung und Mitarbeiter*innenbindung, Leistungsmanagement und Vergütung, Personalentwicklung und Personalfreisetzung. Unterschieden werden bei den Personalrisiken Engpassrisiken (Fehlen von Leistungsträger*innen), Austrittsrisiken (Fluktuation gerade unter Schlüsselpersonen), Anpassungsrisiken (falsch oder unzureichend qualifizierte Mitarbeiter*innen), Motivationsrisiken (Zurückhalten von Leistung, geringes Engagement, Überlastung, „innere“ Kündigung) und Führungsrisiken (nicht auf die Situation, die Personen oder das unternehmerische Leitbild abgestimmtes Führungsverhalten).
Das Projekt durchlief insgesamt drei Phasen: eine Vorbereitungsphase, in der die wichtigsten einzubeziehenden Protagonisten ermittelt, vorhandene Dokumente gesichtet und die Erwartungshaltungen der wesentlichen Akteur*innen ermittelt wurden. Ihr folgte die Phase der Verankerung vor Ort, innerhalb derer in allen drei Unternehmen je zwei Workshops durchgeführt wurden.
Zunächst ging es darum, die wesentlichen Personalrisiken spezifisch zu identifizieren und diese mithilfe von Szenarioanalysen oder vorhandenen Daten zu quantifizieren. Parallel dazu erfolgte ein Coaching, um die praktische Umsetzung des Modells zu begleiten. Beim zweiten Workshop standen dann Probleme bei der Umsetzung des Modells und notwendige Anpassungsschritte im Mittelpunkt. Auch wurden Regularien thematisiert, um das Modell in den Unternehmen langfristig zu etablieren und in deren allgemeines Risikomanagement zu integrieren.
In Phase drei wurde eine Abschlussdokumentation in Form einer Handlungshilfe erstellt und eine öffentliche Abschlusskonferenz mit etwa 70 Teilnehmenden abgehalten.
Impulse für den Transfer
Das Modell konnte in allen drei Fällen erfolgreich umgesetzt werden und wurde auch ein Jahr später noch als erfolgreicher Ansatz zur Steuerung angesehen. Hierfür war die enge Zusammenarbeit der Arbeitnehmervertreter*innen im Betriebsrat und im Aufsichtsrat mit dem Management (vor allem Personal- und Risikomanagement) zentral. Angestrebt war eine betriebliche Kultur, in der Personalrisiken zum Dauerthema auf allen Ebenen des Unternehmens werden, um so das im Modell verankerte Instrumentarium zur Identifizierung und Steuerung von Personalrisiken kontinuierlich weiterentwickeln zu können.
Den Kern des Modells bilden Überlegungen und Hinweise, um Personalrisiken identifizieren, beurteilen und steuern zu können. Bei der Identifizierung von Personalrisiken ging es nicht allein darum, äußere Einflüsse wie demografischer Wandel, Fachkräftemangel oder digitale Transformation auf die Personalsituation eines Unternehmens in den Blick zu nehmen und deren mögliche Folgen zu beschreiben. Das Schwergewicht lag vielmehr darauf, diese vor dem Hintergrund der Unternehmens- beziehungsweise Personalstrategie zu bewerten. Welche Wirkungen auf das Personal kann eine strategische Neuausrichtung haben? Passen Unternehmens- und Wachstumsstrategie mit den vorgesehenen Personalmaßnahmen zusammen? In welchen Bereichen und in welchem Ausmaß können sich Personalrisiken ergeben, die das Kerngeschäft betreffen?
Überdies sieht das Modell vor, die identifizierten Personalrisiken – wie im ersten Workshop geschehen – aufzulisten und deren Relevanz abzuleiten, bevor diese in ein Risikoinventar aufgenommen wurden. Anschließend wurden anhand von Kennzahlen und Szenarien mit Angaben zu Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeiten, alle wesentlichen Risiken quantifiziert.
Prof. Dr. Thomas Berger, ProjektleiterIm Zentrum steht dabei, die relevanten Risiken zu quantifizieren. Dies ist ein überaus wichtiger Schritt, weil dadurch die Implikationen sowie mögliche Kosten veranschaulicht werden können, die entstehen, wenn nicht vorgebeugt wird.
Am prekärsten zeigte sich der ungeplante Weggang von Schlüsselpersonen in einem Partnerunternehmen, einer Klinik. Dieses Risiko alleine hatte bereits die Dimension eines Jahresgewinns, berechnet man die Aufwendungen die durch die Vakanz entstehen können – angefangen von den Kosten für das zusätzliche Recruiting, die Zahlung von Übergangsgeldern für Vertretungen, die mögliche Stilllegung eines ganzen Bereichs, wenn die gesetzliche Mindestbesetzung nicht sichergestellt werden kann und die Aufstockung von anderen Abteilungen beziehungsweise Stationen, die einige der Aufgaben der geschlossenen Station übernehmen müssen. Ebenfalls besonders relevant war das Personalrisiko infolge ansteigender – insbesondere – psychischer Erkrankungen, beispielsweise als direkte Folge von Umstrukturierungen, Überlastungen oder einer mangelhaften Führungskultur. Denn hier sind es häufig längere Ausfallzeiten der Betroffenen, die enorme Zusatzkosten für Gegenmaßnahmen wie Ersatzbeschaffungen oder auch Umsatzausfälle nach sich ziehen.
Die Quantifizierung von „weichen“ Personalrisiken ist auch deshalb wichtig, weil dies die Voraussetzung schafft, um Personalrisiken in das häufig nur an Kennzahlen und Finanzdaten ausgerichtete allgemeine Risikomanagement integrieren zu können.
Die beiden weiteren Bestandteile des Modells – Risikosteuerung und Risikoüberwachung – setzen die Kenntnis und den Einsatz proaktiver Instrumente voraus, zum einen Mentoring und Coaching, aber auch eine rechtzeitige Nachfolgeplanung sowie ständiges und systematisches Monitoring. Bei letzterem empfiehlt es sich, die Wirkungen von Reorganisationen oder Transformationsprozessen mithilfe einer Risikomanagementsoftware zu erfassen, die ein Ampelsystem beinhaltet, mit dem man besonders hohe Risiken frühzeitig erkennen kann. Auch sollte ein Regelzyklus für die Risikoüberwachung festgelegt werden.
Prof. Dr. Thomas Berger, ProjektleiterEs geht darum, eine Betriebskultur zu etablieren, in der eher zuviel als zuwenig über Personalrisiken gesprochen wird. Dazu muss zunächst die Blickrichtung verändert werden: Personaldaten sind keine ‚weichen‘ Daten, sondern harte Faktoren, die sich wie Finanzdaten, Produktionsdaten oder Marketingdaten finanziell kalkulieren lassen.
Dies setzt voraus, dass alle mit dem Modell befassten betrieblichen Akteur*innen regelmäßig geschult werden, um ihren Blick zu erweitern und eine entsprechende Berichtstruktur im Unternehmen aufzubauen. Gleichzeitig ist es notwendig, die Methodik zur Identifizierung und Quantifizierung von Personalrisiken ständig weiter zu verfeinern.
Ansprechpersonen des Projektes
Projektleiter:
Prof. Dr. Thomas Berger, DHBW Stuttgart, Fakultät Technik – Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
Weitere Kooperationspartnerschaften:
Susanne Thomas, IG Metall Bezirksleitung Baden-Württemberg / Verwaltungsstelle Ludwigsburg
Grit Genster, ver.di Bundesverwaltung
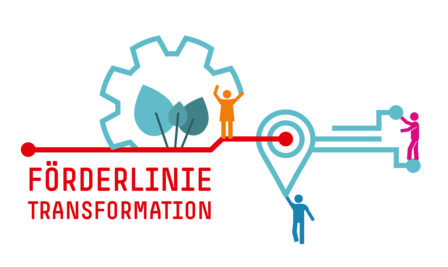
Förderlinie Transformation
Es gibt viele Treiber von Transformationsprozessen: Digitale Transformation, Klimawandel, Energiekrise etc. Folgen sind hoher Veränderungsdruck in Betrieben, Branchen und Regionen und für die dort arbeitenden Menschen. Im Zentrum der Förderlinie steht: Wir bringen Erfahrungswissen und akademisches Wissen gewinnbringend zusammen – betrieblich, regional, lösungsorientiert. Das Ziel ist, mit kurzformatigen Projekten dem hohen Veränderungsdruck in der Arbeitswelt Rechnung zu tragen. Die Veränderungsdynamiken und ihre Anforderungen an Mitbestimmungsprozesse und ihre Akteure sollen wissenschaftlich beraten und begleitet werden.