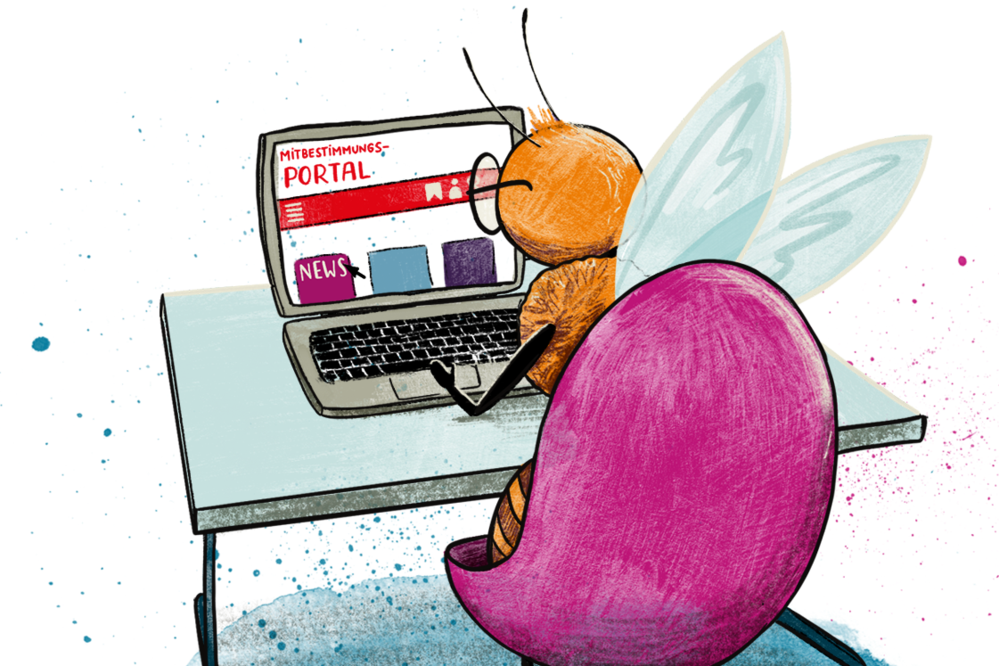Exzellenz hat ihren Preis
Gutachten: Öffentliche Investitionsbedarfe und deren Finanzierung
Die sozial-ökologische und digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft kann nur gelingen, wenn sie durch öffentliche Investitionen unterstützt und durch die öffentlichen Haushalte finanziell flankiert wird. Ein Gutachten zeigt am Beispiel Baden-Württembergs, was getan werden muss, um diese Förderung effektiv leisten, damit das Land weiterhin seinen Exzellenz-Status bewahren kann.
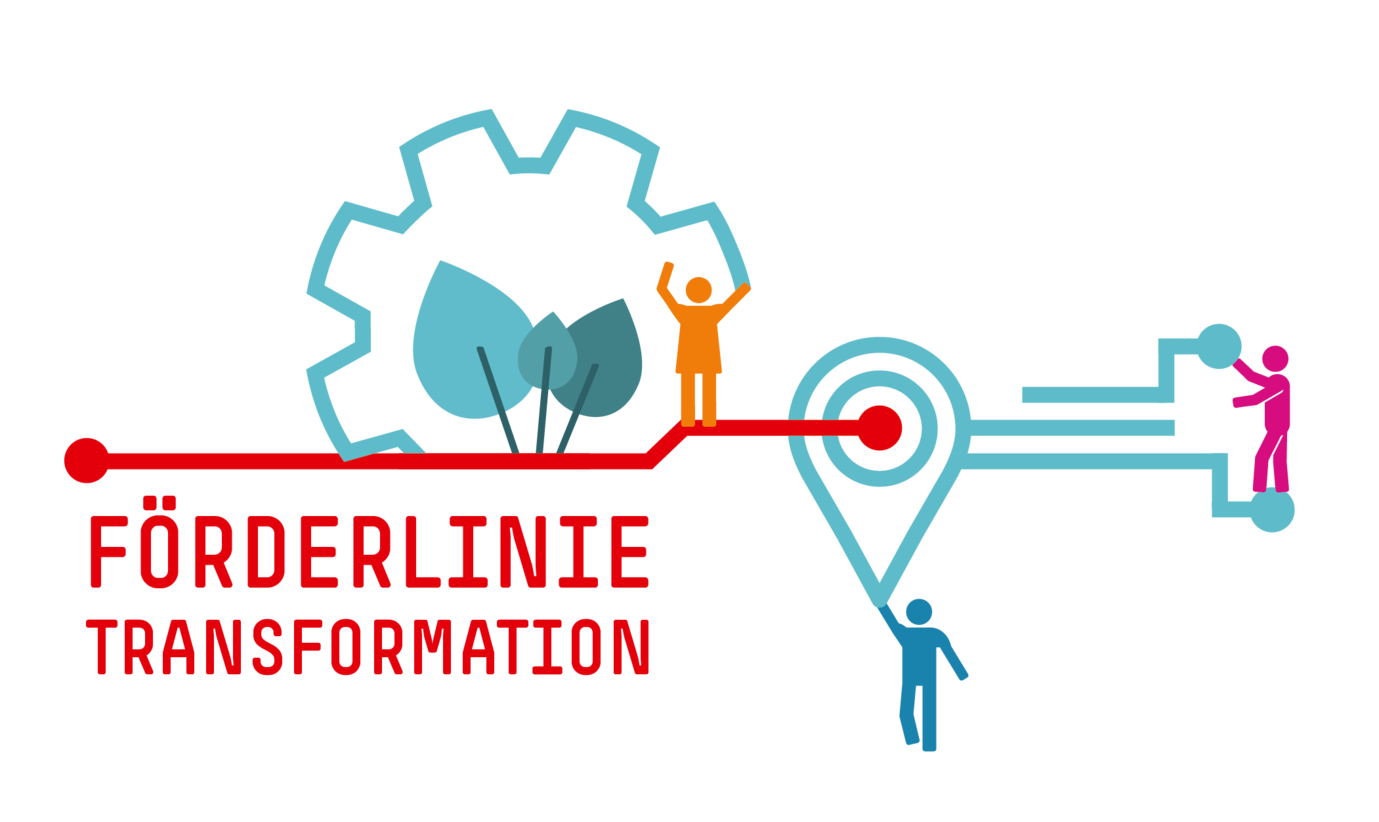
Die aktuelle Finanzkrise im Bund hat ihr Pendant in den Bundesländern. Auch sie stehen vor der Herausforderung, trotz knapper öffentlicher Haushalte die Transformation voranzubringen und zu fördern – und dabei die gesetzlich vorgegebene Schuldenbremse einzuhalten.
Baden-Württemberg gilt als moderner Wirtschaftsstandort. Aber bei näherer Betrachtung tut sich das Land schwer, die Anforderungen, die es in der doppelten – digitalen und sozial-ökologischen – Transformation zu stemmen hat, bewältigen zu können. Kritisch betrachtet, kann die Finanzpolitik der Landesregierung als – im Vergleich zu anderen Bundesländern – zurückhaltend gewertet werden. Und dies trotz erheblicher Defizite in der öffentlichen Infrastruktur. Außerdem lassen sich vielfältige Modernisierungsdefizite beobachten, die die wirtschaftliche Dynamik des Landes bremsen. Damit läuft es Gefahr, seine im Ländervergleich starke wirtschaftliche Position („Exzellenz“) zu schwächen, wenn nicht sogar diese Position zu verspielen, sollte sich die Landesregierung nicht schon bald auf den notwendigen Pfadwechsel begeben.
Aus dieser Erkenntnis heraus wandte sich der DGB Baden-Württemberg Anfang 2024 an die Forschungsgruppe für Strukturwandel und Finanzpolitik in Hannover mit der Bitte, im Rahmen eines Projekts der Förderlinie Transformation der Hans-Böckler-Stiftung ein Gutachten über öffentliche Investitionsbedarfe in Baden-Württemberg und deren Finanzierung zu erstellen. Er versprach sich davon, konkrete Daten über die aktuelle finanzielle und wirtschaftliche Situation des Landes zu erhalten. Darüber hinaus sollten ihm die Daten als Basis dienen, um als relevanter Akteur auf allen Ebenen – Land, Bezirk, Kommune – eine politische Debatte über die Rolle der öffentlichen Haushalte in Zeiten der Transformation anzustoßen und hierbei auch innovative Wege und Instrumente zur Finanzierung der notwendigen Investitionen – selbst unter Berücksichtigung der gesetzlichen Schuldenbremse – ins Gespräch zu bringen.
Nach den Fallbeispielen Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Sachsen hat sich das Projektteam um Torsten Windels (Projektleiter), Dr. Juliane Bielinski und Dr. Arno Brandt von der Hannoveraner Forschungsgruppe für Strukturwandel und Finanzpolitik nun auch – auf Initiative des DGB – mit den öffentlichen Investitionsbedarfen in Baden-Württemberg und deren öffentlicher Finanzierung durch die Landesregierung befasst. Seine Ergebnisse fasst das Projektteam in dem im Oktober 2024 öffentlich vorgestellten Gutachten „Exzellenz kommt nicht von alleine – Öffentliche Investitionsbedarfe und deren Finanzierung in Baden-Württemberg“ zusammen.
Auf der Basis eines breiten Daten-Mixes von Forschungsberichten und Analysen von Forschungsinstituten, Ministerien, Verbänden, Stiftungen und einschlägiger Fachliteratur, themenspezifischen öffentlichen Statistiken und Sonderauswertungen untersucht die Studie die Stärken und Schwächen der Finanzpolitik in Baden-Württemberg wie auch die des Kapitalstocks des Landes und errechnet beziehungsweise beschreibt die Investitionsbedarfe in fünf landespolitisch wichtigen Feldern (Klimaneutralität, Infrastruktur, Wohnen, Bildung, Gesundheit). Bei den darauf aufbauenden Finanzierungsempfehlungen wird stets die gesetzlich bestehende Schuldenbremse mitberücksichtigt.
Ziel des Projekts ist es, die regionalen, politischen und gewerkschaftlichen Akteur*innen argumentativ zu unterstützen, innovative Leitbilder für die regionale Gestaltung der Transformation in Baden-Württemberg zu entwickeln, entsprechende Investitionsanforderungen zu stellen und darauf bezogene realistische Finanzierungsmöglichkeiten in den öffentlichen Diskurs zu tragen.
Das Projekt startete im April 2024 und endete im Oktober 2024 mit der öffentlichen Präsentation der Ergebnisse auf einer Pressekonferenz des DGB Baden-Württemberg.
Exzellenz-Status in Gefahr
Das Gutachten beginnt mit einer Bestandaufnahme der Wirtschaftsstruktur und -entwicklung Baden-Württembergs. Danach präsentiert sich das Land als struktur- und industriestarke Region mit hohem Innovationspotenzial. In vielen Bereichen nimmt es im Ländervergleich eine Spitzenposition ein, so etwa bei der Wertschöpfung und dem Export. Hier haben sich bedeutende Großunternehmen aber auch eine innovative mittelständische Wirtschaft angesiedelt. Im Umfeld vieler Unternehmen gibt es leistungsstarke Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.
Bei näherem Hinsehen zeigen sich allerdings Defizite, die das Land die herausragende Position – möglicherweise sogar in kürzester Zeit – kosten könnte. Die starke Ausrichtung der Wirtschaft auf den Export beispielsweise wird das Land bei wachsenden internationalen Handelsbeschränkungen voraussichtlich stärker treffen als andere Bundesländer. „Wer ganz vorne steht, kann schnell zurückfallen und viel verlieren, wenn sich die Situation ändert“, sagt Projektleiter Torsten Windels. „Um in der Transformation Exzellenz zu erhalten, muss sich das Land vorwärts begeben. Exzellenz kommt nicht von allein.“
So hat sich das Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum seit der globalen Finanzkrise 2008/9 in Baden-Württemberg deutlich verlangsamt und sich bis heute dem Bundesdurchschnitt weitgehend angenähert. Als problematisch könnte sich vor allem die bundesweit zu beobachtende „Verschlankung“ des öffentlichen Dienstes erweisen. Dabei gewährleistet dieser Bereich wesentlich die Funktionsfähigkeit der Daseinsvorsorge – auch in Baden-Württemberg.
Bei der Arbeitsproduktivität hat sich die Dynamik in den letzten Jahren ebenfalls deutlich abgeschwächt. Selbst seinen Vorsprung auf dem Feld der Innovationen konnte das Land kaum ausbauen.
Hinzu kommt: Gerade in den für eine nachhaltige Zukunftsentwicklung zentralen Bereichen wie Klimaschutz, Infrastruktur und Fachkräfteentwicklung steht Baden-Württemberg ebenfalls nicht mehr besonders gut da. Mit Blick auf die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Relation zur Bevölkerung liegt das Land gerade mal noch im Mittelfeld der Bundesländer. In nahezu allen Wirtschaftsbereichen herrscht ein ausgeprägter Fachkräftemangel. Baden-Württemberg will zwar bis 2040 klimaneutral sein, aber bisher geschieht der CO2-Abbau insgesamt noch viel zu langsam. Daraus ergibt sich eine erhebliche Klimaschutzlücke, die die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft bedroht. Marode Straßen, ein unzulänglich ausgebauter Öffentlicher Personennahverkehr, ein unzureichender Ausbau der Breitbandverkabelung und der Leitungsnetze für Wasserstoff und mehr grünem Strom, nicht zuletzt fehlende Speicherkapazitäten für alternative Energien sind weitere Faktoren, die den notwendigen transformativen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft erschweren. Dazu zählt auch ein an den Herausforderungen der Zukunft unzureichend ausgerichtetes Wohnungs-, Gesundheits- und Bildungswesen, an denen in den letzten 20 Jahren gespart wurde.
Der gesamte Kapitalstock, also der Bestand an Sachkapital in der baden-württembergischen Volkswirtschaft – dazu zählen Gebäude, Maschinen, Straßen, Schienen sowie Ausgaben für Forschung und Entwicklung) – ist teils stark veraltet und müsste deshalb, nach dem Gutachten, dringend modernisiert werden.
Leitprinzip „schwäbische Hausfrau“
Auch herrscht noch immer das „Denken der schwäbischen Hausfrau“ vor, das den Blick vor allem auf die Ausgaben und Kosten lenkt und weniger auf die Zweckmäßigkeit und Qualität des Geldausgebens. Öffentliche Investitionen werden verzögert, weil sie oft in der Kritik stehen, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen schwächen und private Investitionen verhindern. „Das Gegenteil ist der Fall“, betont Torsten Windels. „Gerade in den letzten Jahren haben öffentliche Investitionen oftmals erst die Voraussetzung geschaffen, damit Private investieren und Unternehmen ihre Geschäftsfelder ausweiten oder ihre Produkte kostensparend herstellen konnten.“
Das betrifft insbesondere Ausgaben für die Modernisierung der Infrastruktur. Kaputte Straßen oder ein unzureichendes Schienennetz erschweren es, Exportgüter auf schnellem Wege von A nach B zu bringen und verteuern den Transport. Ein lahmes Internet hindert Unternehmen daran, Funktionen und Prozesse weitreichend zu digitalisieren und damit kostengünstiger und effizienter zu produzieren. Das führt dazu, dass Baden-Württemberg in puncto Elektromobilität zurzeit stark zurückfällt. Auch fehlende öffentliche Investitionsanreize verzögern private Investitionen.
Torsten Windels, ProjektleiterWas wir sehen, sind diverse Versäumnisse in der Vergangenheit. Das führt zu einer starken Differenz zwischen den Investitionen, die nötig sind und denen die effektiv getätigt werden.
Dass gerade Baden-Württemberg bis heute akribisch an der Landesschuldenbremse festhält, dürfte ebenfalls dem „schwäbische Hausfrau“-Prinzip zuzuschreiben sein. „Der Staat darf sich nicht verschulden: Dieses Vorurteil ist noch immer vorherrschend. Dabei ist doch Fakt, dass Staatshaushalt und private Haushalte nicht nach den gleichen Prinzipien funktionieren“, so Windels.
Aktuelle Finanzkraft reicht nicht aus
Das Land ist zwar finanzstark und verfügt im Ländervergleich über das dritthöchste Steueraufkommen pro Einwohner. Es ist auch vergleichsweise niedrig verschuldet. Auch zeigt es sich in schwierigen Zeiten in der Finanzpolitik flexibel: So etwa reagierte die Landesregierung in der Zeit der Corona-Pandemie mit einer Aussetzung der Schuldenbremse und beschloss zwei Nachtragshaushalte, eine Erweiterung des Kreditrahmens und langfristige Tilgungspläne. Überdies können rund achtzig Prozent der Kommunen in Baden-Württemberg auf Rücklagen zurückgreifen, um ihren Haushalt abzuschließen. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass nach Ansicht der Kommunalverbände der Gesamtstaat die Grenze seiner Leistbarkeit erreicht hat. Folglich reicht die bis heute beachtliche Finanzkraft des Landes nicht aus, um zukunftsfähig zu bleiben.
Allein schon im Straßenverkehr tun sich immer größere Lücken auf, da die staatlichen Investitionen in den Bau von Brücken und Erhalt von Straßen und Autobahnen einem rasanten Werteverzehr unterliegen, der den Ländern immer mehr Ausgaben abnötigt, um den Verfall von Straßen und andere Verkehrsmängel zu beseitigen oder zumindest abzumildern. Das heißt: Auch wenn das Land seine Investitionen in Infrastruktur in den letzten Jahren ausgebaut hat, reichten die eingesetzten Mittel kaum aus, um den Verfall der Straßen aufzuhalten.
Fakt ist ebenfalls, dass Baden-Württemberg im Ländervergleich zwar über eine große Menge an Finanzmitteln im Haushalt für Investitionen verfügt, dieses aber nicht „auf die Straße“ bringen kann. „Es herrscht oft weniger ein Geld-, als vielmehr ein Realisierungsmangel“, berichtet Projektleiter Windels. Ursächlich dafür sind unter anderem lang andauernde Genehmigungs- und komplizierte Planungsverfahren, das langsame Tempo und Defizite bei der Digitalisierung, aber auch zu wenig Personal in einzelnen Bereichen. Aktuell kann das Land aus diesen Gründen rund zehn Milliarden Euro für bereits bewilligte Investitionen nicht realisieren. „Damit ergibt sich eine Kettenreaktion: Die mangelnde Investitionsfähigkeit oder -bereitschaft der Landesregierung geht zulasten der Wachstumsdynamik und damit der Wohlstandsproduktion“, schlussfolgert der Wissenschaftler.
| Projekte ... | ...werden nicht durchgeführt | ...werden abgespeckt durchgeführt | …verzögern sich um mind. 1 Jahr | …verteuern sich um mehr als 25% |
|---|---|---|---|---|
| Unzureichende Eigenmittel (Zuweisungen, Steuereinnahmen) |
55 |
42 | 41 | 24 |
| Komplexe Fördermittelbeantragung | 25 | 13 | 43 | 18 |
| Langwierige Bearbeitung von Förderanträgen durch die Bewilligungsstellen | 17 | 9 | 57 | 23 |
| Komplexe, zeitaufwendige Vergabeverfahren | 12 | 8 | 60 | 26 |
| Komplexe baurechtliche Vorgaben | 12 | 8 | 55 | 32 |
| Komplexe Genehmigungsverfahren | 10 | 7 | 60 | 25 |
| Personalmangel in Bauverwaltung (Hoch-/Tiefbauamt) | 29 | 16 | 56 | 19 |
| Preissteigerung in der Bauwirtschaft | 63 | 66 | 31 | 48 |
| Zu geringe Anzahl von Angeboten bei Ausschreibungen | 52 | 46 | 72 | 28 |
Quelle: KfW Research: Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kommunalpanel 2024, Mai 2024S. 19-23, Auswahl, Mehrfachantworten möglich
© FSF Hannover
Gut kalkulierter Investitionsbedarf
Das Gutachten hat sich fünf Bereiche intensiver angeschaut, um vorhandene Defizite, die die Zukunftsfähigkeit des Landes behindern, und entsprechende Investitionsbedarfe genauer ausmachen zu können. Zum Schluss befasst es sich mit der Frage, wie die für eine stabile Zukunftsentwicklung als notwendig erkannten Investitionen finanziert werden können.
Insgesamt 166,6 Milliarden Euro benötigt Baden-Württemberg in den nächsten zehn Jahren, um seine wirtschaftliche Spitzenposition im Ländervergleich erhalten beziehungsweise wieder erringen kann. Das sind jährlich knapp 16,7 Milliarden Euro. Für die fünf zentralen Politikfelder hieße das: jährliche Ausgaben für den Klimaschutz in Höhe von 5,5 Milliarden Euro, für die Infrastruktur von insgesamt 5,3 Milliarden Euro, für die Schaffung von 13.000 Sozialwohnungen pro Jahr von 1,8 Milliarden Euro, für das Gesundheitswesen von 1,2 Milliarden Euro und für das Bildungswesen von 2,8 Milliarden Euro.
| Politikfeld | Maßnahmen | Ansatz Kap. 3 Mrd. EUR |
2024-2033 Mrd. EUR |
Jährlich Mio. EUR |
|---|---|---|---|---|
|
Klimaschutz darunter |
Insgesamt
|
55,5 38,8
|
55,5 38,8 16,6 |
5.547 3.884 1663 |
|
Infrastruktur darunter |
Insgesamt (nur Landesanteil)
|
1,50
1,80 31,83
7,20 5,26 |
52,90 1,50
1,80 31,83
9,00 1 8,77 1 |
5.290 150
180 3.183
900 877 |
| Wohnen |
Schaffung von 13.000 Sozialwohnungen pro Jahr
|
18,2 11,0 7,2 |
18,2 11,0 7,2 |
1.820 1.100 720 |
| Gesundheit |
Insgesamt (Mittelwert)
|
1,61 |
11,7
1,34 1 |
1.179
134 |
| Bildung |
Insgesamt
|
8,2 1,7 6,9 11,4 |
28,2 8,2 1,7 6,9 11,4 |
2.820 820 170 690 1.140 |
| Summe | 166,6 | 16.656 |
Anmerkungen: Hier werden die Gesamtbedarfszahlen abgebildet. Teilweise stehen diesen bereits Haushaltsansätze gegenüber. Diese sind hier nicht ausgewiesen. 1 linear angepasst (ohne Preissteigerungen) 2 Mittelwert
Quelle: FSF 2024
© FSF Hannover
Beim Klimaschutz müsste sich das Tempo beim CO2-Abbau um den Faktor 7,1 steigern. Vor allem beim Windkraftausbau bedarf es künftig erheblicher Anstrengungen.
Baden-Württemberg ist ferner gefordert, den Investitionsstau der letzten Jahre vor allem im Bereich der öffentlichen Infrastruktur aufzulösen. Das betrifft insbesondere den Breitbandausbau, die Sanierung von Landesstraßen und des Schienenverkehrs. Ferner notwendig sind erhebliche Investitionen in Fahrzeuge für den ÖPNV, um die nachhaltige Verkehrswende voranzubringen. Weitere Investitionen sind in die Energie- und Wärmenetze erforderlich, um diese zu erhalten und zu sanieren – wenngleich diese zum großen Teil aus Nutzer*innentgelten finanziert werden.
Auch im Wohnungswesen stehen erhebliche Investitionen an, um im Land vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum bereitstellen zu können. Die 2024 für die Wohnraumförderung zur Verfügung gestellten 551 Millionen Euro reichen aber bei weitem nicht aus, um privaten Investoren Anreiz zu geben, den Wohnungsbau zu beleben. Es müssten mindestens eine Milliarden Euro sein, fordert der IG BAU Baden-Württemberg. Aber noch dringlicher wäre der Ausbau des Sozialen Wohnungsbaus. Daher fordert das Gutachten zusammen mit dem DGB Baden-Württemberg nicht nur die Sanierung von mietpreisgebundenen Sozialwohnungen, sondern zugleich die Beschaffung von weiteren 13.000 Wohneinheiten.
Ein Sanierungsfall der besonderen Art ist das baden-württembergische Gesundheitssystem. Das Land verfügt zwar über eine sehr effiziente Krankenhausversorgung. Auch liegen die Krankenhauskosten je Einwohner*in und Jahr dort deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Wissenschaftliche Analysen gehen dennoch von einem hohen Investitionsbedarf aus, da in den vergangenen Jahrzehnten ein enormer Sanierungsstau in den Krankenhäusern entstanden ist. Mit ihrem Jahreskrankenhausausbauprogramm 2024 hat die Landesregierung zwar bereits vorgesorgt und ein Volumen von 248 Millionen Euro – und damit deutlich mehr als andere Bundesländer – bereitgestellt. Aber wichtige Institutionen wie die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft oder der DGB Baden-Württemberg gehen von einem Finanzierungsvolumen zwischen 800 und 850 Millionen Euro pro Jahr aus. Den mittlerweile aufgelaufenen Sanierungsstau beziffern sie auf 2,2 Milliarden Euro. Danach müsste das Land seine jährliche Investitionsfinanzierung um mindestens 300 Millionen Euro erhöhen.
Hinzu kommen hohe öffentliche Aufwendungen in die Pflegeinfrastruktur. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Baden-Württemberg wird in den nächsten Jahren überdurchschnittlich stark zunehmen. Dementsprechend wird der finanzielle Bedarf an Investitionen im Pflegesektor steigen. Dies betrifft nicht nur die Bereitstellung von mehr Pflegeplätzen in Pflegeheimen, sondern auch Anstrengungen, um dem in der Pflege besonders ausgeprägten Fachkräftemangel zu begegnen. Allein im Jahr 2040 müsste das Pflegepersonal um 30 Prozent verglichen mit 2021 gesteigert werden, im Jahr 2060 sogar um 70 Prozent. Bis 2035 müssten rund 13.400 weitere Pflegeplätze geschaffen werden.
Auch bei der Bildung – einer originären Landesaufgabe – muss sich künftig einiges tun, um das Land weiterhin wirtschaftlich im oberen Rang anzusiedeln. Zwar schneidet das baden-württembergische Bildungswesen besonders gut in den Bereichen Digitalisierung (Forschung, Ausbildung, Medieneinsatz)), Betreuungsbedingungen (Kitas, Schulen, Hochschulen), Hochschule/MINT (Zahl der Studierenden/Absolvent*innen) und bei der beruflichen Bildung ab. Es erzielt überdies hohe Zufriedenheitswerte der Bevölkerung bezüglich der Schulen, insbesondere der Grundschulen. Aber bei den Qualitätsrankings droht das Land zurückzufallen. Nicht zuletzt besteht auch in diesem Bereich – angefangen bei den Hochschulen bis zu den Schulen, Ganztags-, Grundschulen und Kitas – ein großer Investitionsrückstand und Sanierungsstau.
Finanzmittel langfristig mobilisieren
Die veranschlagten Investitionsbedarfe nehmen sich im Vergleich zum geplanten Investitionsvolumen des Landeshaushalts von rund 6,5 Milliarden Euro pro Jahr riesig aus und zeigen, dass zu ihrer Finanzierung ein Umdenken stattfinden muss. Es stellt sich daher die Frage, wie hierfür ausreichend finanzielle Mittel mobilisiert werden können. Dabei stehen – nach dem Gutachten – folgende drei Aufgaben im Mittelpunkt: der Abbau des aufgelaufenen Investitionsstaus, eine Erhöhung der Resilienz des Landes mit Blick auf die jüngsten Krisen (Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Migration) und die Lösung dringender Aufgaben (Eindämmen der Klimakrise, Bewältigung des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels, fortschreitende Digitalisierung). Vor allem müssten die Kommunen, die immerhin „das Gesicht des Staates zum Bürger“ und wichtige Investitionsträger sind, stärker unterstützt werden.
Als vorrangige Maßnahme empfiehlt das Gutachten, gegebene Handlungsspielräume innerhalb der baden-württembergischen Schuldenbremse stärker zu nutzen. Den Autor*innen der Studie geht es nicht darum, die gesetzliche Schuldenbremse auszuhebeln, sondern sie angesichts des immensen Investitionsbedarfs kreativ anstatt wie in der Vergangenheit restriktiv zu handhaben. Wie während der Corona-Pandemie komme es heute in der Transformation darauf an, flexibel zu sein und das gegebenen Finanzinstrumentarium zur Nettokreditaufnahme voll auszuschöpfen.
Besonders hervorgehoben wird in dem Gutachten, dass sich Baden-Württemberg künftig selbst stärker unternehmerisch engagieren sollte. Dies vor allem in Form von bereits bestehenden Beteiligungen und dem Ausbau beziehungsweise der Gründung von Landesgesellschaften. So etwa verfügt Baden-Württemberg bereits über 91 unmittelbare und eine Vielzahl von mittelbaren Beteiligungen in verschiedenen Sektoren und Rechtsformen. Denkbar wäre beispielsweise, die Beteiligungen des Landes insbesondere im Bereich des ÖPNV/Mobilität und der Energie/Wärme/Leitungsnetze mit mehr Eigenkapital auszustatten, sodass sie künftig auch und mehr Aufgaben zur Investitionsfinanzierung in den Bereichen Infrastruktur und Klima übernehmen könnten. Die Eigenkapitalerhöhungen könnte das Land durch Kredite finanzieren, da diese „finanziellen Transaktionen“ nicht der Schuldenbremse unterfallen.
Öffentliche Investitionsgesellschaften haben den Vorteil, dass sie ohne gesetzliche Anpassungen der Schuldenbremse bei der Finanzierung des Investitionsbedarfs des Landes eine zentrale Rolle spielen können. So etwa lassen sie sich in allen betrachteten Aufgabenbereichen – Wohnen, Infrastruktur, Klima, Gesundheit, Bildung – ansiedeln und haben unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, Kredite außerhalb der Kernhaushalte aufzunehmen. Da diese Investitionsgesellschaften als Marktproduzenten nicht Teil des Staatssektors sind, werden ihre Kredite nicht auf die Schuldenbremse angerechnet. Im Gutachten wird deshalb unter anderem vorgeschlagen, die bisherige Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg zu einer Infrastrukturinvestitionsgesellschaft unter anderem für Hochschulen, Schulen, Krankenhäuser weiterzuentwickeln. Ebenso empfiehlt es die Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft.
Ferner sieht das Gutachten für die Landeskreditbank Baden-Württemberg die Möglichkeit, ihre Fördertätigkeit auszuweiten – gerade auch vor dem Hintergrund der „Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie und des Energiepreisschocks nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine“ (S. 102). Nicht zuletzt sollten Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP) Anreiz erhalten, für die Finanzierung von notwendigen öffentlichen Aufgaben etwa im Bereich der Energiewende privates Kapital zu mobilisieren (Beispiel: Energiewende-Fonds).
Fazit: „Sowohl als auch“-Lösungen
Das Gutachten eröffnet einen neuen Blick auf die Rolle der Landesfinanzen für die Zukunftsgestaltung des Industriestandorts Baden-Württemberg. Dieser richtet sich nicht nur auf die Ausgabenseite, sondern vor allem auf Gestaltungsmöglichkeiten, die es zu nutzen gilt, um mit neuen Instrumenten und durch Ausschöpfen gegebener Spielräume die Finanzierung des darin festgehaltenen Investitionsbedarfs zu gewährleisten.
Die Leitidee der Studie lautet: Öffentliche Investitionen stärken private Investitionen, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Die hierfür benötigten Finanzmittel sollen aus Sicht der Autor*innen vor allem dadurch aufgebracht werden, dass vorhandene Mittel (Ausgabenreste, Rücklagen) stärker genutzt, die Rahmenbedingungen für Investitionen verbessert und die Investitionsmöglichkeiten der öffentlichen Hand erweitert werden. Dazu zählen
- schnellere und unkomplizierte Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie der Ausbau von Baukapazitäten,
- die Nutzung beziehungsweise Schaffung von öffentlichen Investitionsgesellschaften,
- die finanzielle Unterstützung privater Unternehmen bei der Transformation.
Die in dem Gutachten aufgeführten Investitionsbedarfe und darin angesprochenen Finanzierungsinstrumente werden mittlerweile öffentlich diskutiert. Wie sich zeigt, wird das berechnete Investitionsvolumen kaum bestritten.
Der DGB Baden-Württemberg hatte die Studie Anfang Oktober 2024 auf einer Pressekonferenz vorgestellt, um dadurch eine breite Zukunftsdebatte auf allen Ebenen des Landes anzustoßen, die darauf fokussiert, die öffentliche Daseinsvorsorge insbesondere auf den Feldern Klimaschutz, Infrastruktur, Wohnen, Gesundheit und Bildung sicherzustellen und deren gerechte Finanzierung zu gewährleisten. Deshalb verbindet er sie mit der Diskussion um eine Reform der Schuldenbremse und den Vorstellungen des DGB zu einem gerechten Steuerkonzept.
Das Gutachten nutzt er ferner als argumentative Basis, um die Sicht zu erweitern: weg von dem „Entweder oder“-Blickwinkel der „schwäbischen Hausfrau“ und hin zu „Sowohl-als auch“-Betrachtungen, die sozialen Ausgleich, Wachstum und Klimaschutz miteinander verbinden. Damit will der DGB verhindern, dass die Sozial- gegen die Investitionspolitik und die Klima- gegen die Wachstumspolitik ausgespielt wird. Es geht schließlich darum, in einem breiten Bündnis regionaler Akteur*innen die Zukunftsfähigkeit des Landes zu stärken und gleichzeitig Wertschöpfung und Beschäftigung zu sichern.
Ansprechpersonen des Projektes
Projektleiter:
Torsten Windels
Projektbearbeitung:
Dr. Juliane Bielinski, Forschungsgruppe für Strukturwandel & Finanzpolitik
Dr. Arno Brandt, Forschungsgruppe für Strukturwandel & Finanzpolitik
Weitere Kooperationspartner:
Gerri Kannenberg, DGB-Bezirk Baden-Württemberg
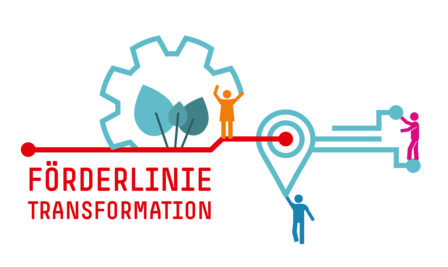
Förderlinie Transformation
Es gibt viele Treiber von Transformationsprozessen: Digitale Transformation, Klimawandel, Energiekrise etc. Folgen sind hoher Veränderungsdruck in Betrieben, Branchen und Regionen und für die dort arbeitenden Menschen. Im Zentrum der Förderlinie steht: Wir bringen Erfahrungswissen und akademisches Wissen gewinnbringend zusammen – betrieblich, regional, lösungsorientiert. Das Ziel ist, mit kurzformatigen Projekten dem hohen Veränderungsdruck in der Arbeitswelt Rechnung zu tragen. Die Veränderungsdynamiken und ihre Anforderungen an Mitbestimmungsprozesse und ihre Akteure sollen wissenschaftlich beraten und begleitet werden.