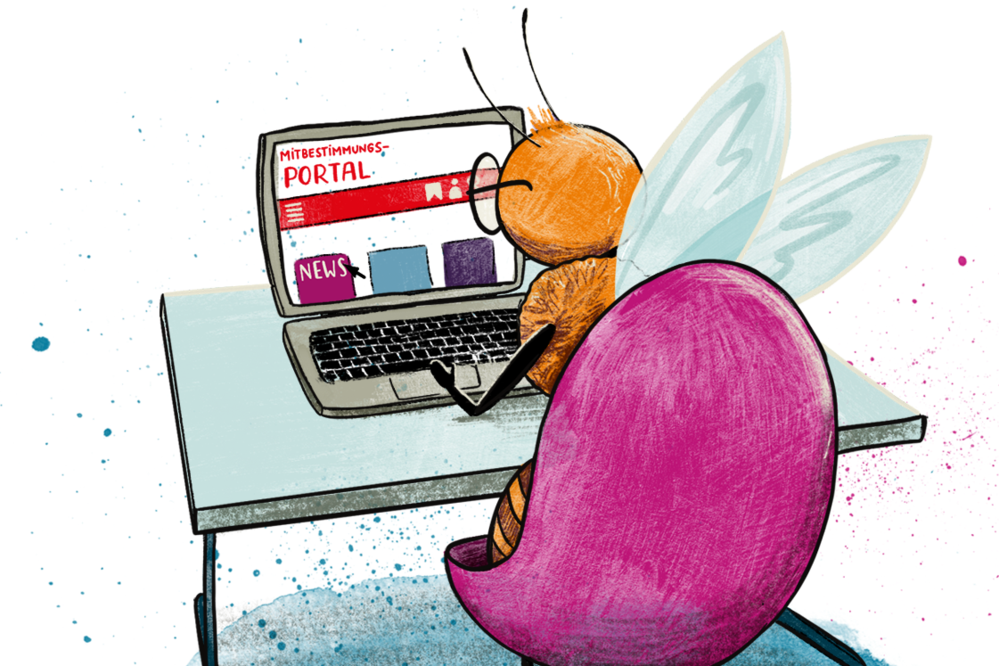Regionale Stabilisierungsfaktoren erkennen
Resiliente Regionen als Ziel von Transformation
Globale, demografische und technische Verschiebungen wirken sich in den Regionen unterschiedlich aus. Damit sich letztere stabil und zukunftsfähig entwickeln können, bedarf es resilienter Strategien.
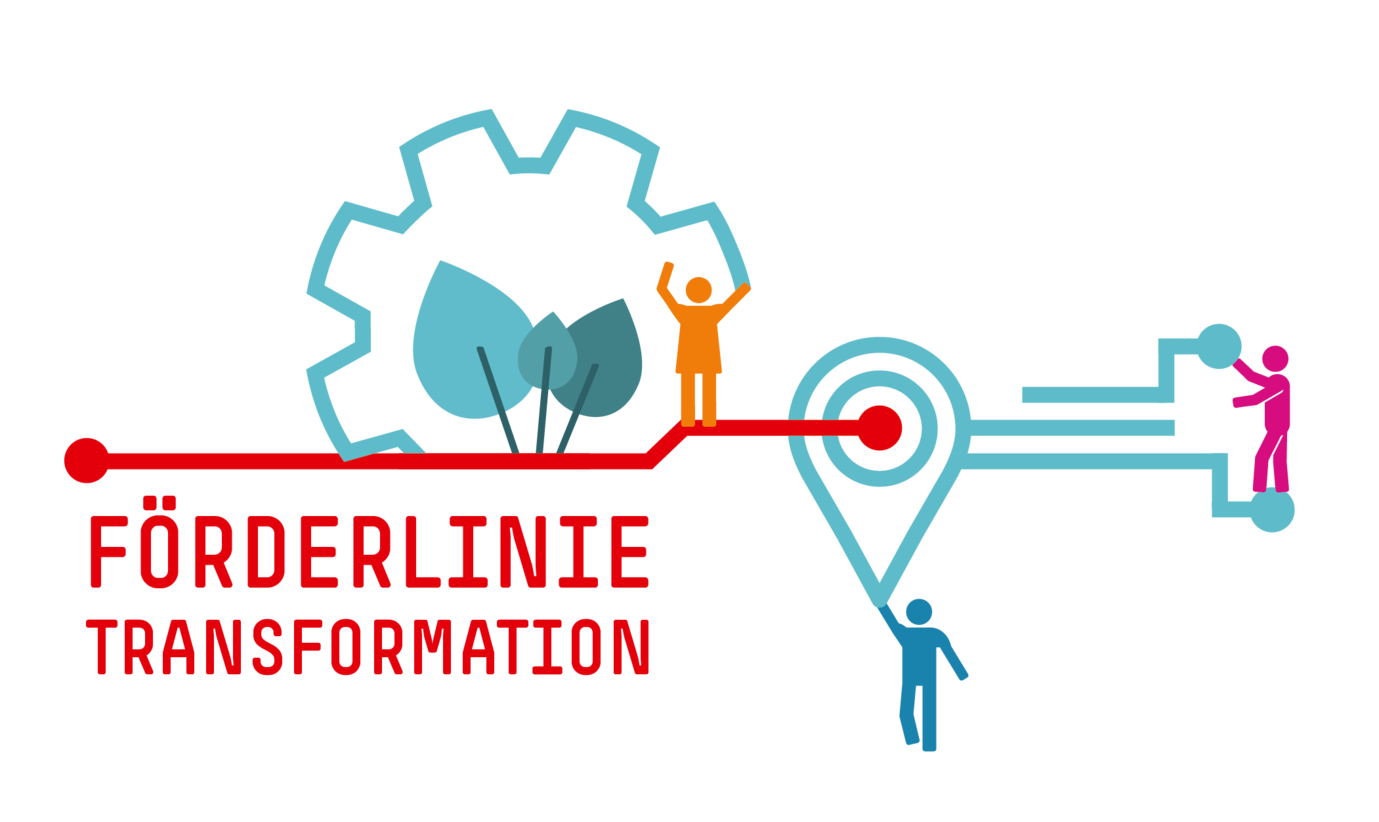
Die großen Herausforderungen, mit denen bundesweit alle Regionen befasst sind – Globalisierung und vulnerable Lieferketten, Dekarbonisierung und Energiewende, demografischer Wandel, Digitalisierung und KI – treffen diese in unterschiedlicher Intensität und Dynamik. Wie sich die Regionen zukünftig weiterentwickeln, hängt entscheidend von ihrer Fähigkeit ab, negative Auswirkungen von Krisen abmildern und sich flexibel an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen zu können – und damit von ihrer ökonomischen und gesellschaftlichen Resilienz.
Doch was sind die entscheidenden Stellschrauben, mit denen die relevanten Akteur*innen ihre Region in Zeiten von Transformation, Krise und Unsicherheit nicht nur stabilisieren, sondern zukunftsfähig und entsprechend ihren eigenen Erkenntnissen und Leitideen gestalten und eventuell neu ausrichten können?
Diese Frage bewegt den DGB in der Region Nahetal-Hunsrück schon seit langem. Er selbst ist deshalb – gemeinsam mit der IG Metall – aktuell dabei, ein regionales Transformationsnetzwerk in der Region zu gründen, dem auch andere regionale Akteur*innen angehören werden. Dazu zählen unter anderem die Wirtschaftsförderungen der Landkreise Birkenfeld, Rhein-Hunsrück, Mainz-Bingen und Bad Kreuznach wie auch Vertreter*innen der Agentur der Arbeit Bad Kreuznach und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung (MASTD) Rheinland-Pfalz.
Der Transformationsdruck in den Unternehmen und Kommunen der Region ist groß. Das schweißt die regionalen Akteur*innen enger zusammen. Denn die Themen, die sie bewegen, sind vielfältig. Auf der Tagesordnung allein der in der Region Nahetal-Hunsrück ansässigen, vorwiegend der Metall- und Chemiebranche zugehörigen Unternehmen, stehen Aktivitäten, die eigenen Produkte neu zu denken und insbesondere auf Alternativen zum Verbrennermotor abzustellen, ihre Produktion und Dienstleistungen am Leitbild ökologischer Nachhaltigkeit auszurichten – unter anderem durch Reduktion des CO2-Ausschusses, mehr Energieeffizienz und den Umstieg auf „grüne“ Energie, „grünen“ Stahl usw. –, die Lieferketten weniger störanfällig zu machen und andauernden Fachkräfteengpässen zu begegnen.
Die Idee der Initiatoren ist es, das regionale Transformationsnetzwerk zu einer zentralen Anlaufstelle für Betriebe und Beschäftigte rund um die vielfältigen Veränderungen ihrer Arbeits- und Lebenswelt zu entwickeln. Gleichzeitig möchten sie es zu einem Ort machen, an dem die Herausforderungen in der Region gemeinsam analysiert und darauf aufbauend eine regionale Zukunftsstrategie erarbeitet wird, die Vorschläge und Maßnahmen für politische, soziale, kulturelle und betriebliche Maßnahmen entwickelt.
Um den Start des Netzwerks zu erleichtern, beantragten sie ein begleitendes Projekt im Rahmen der Förderlinie Transformation der Hans-Böckler-Stiftung. Dessen Ziel ist es, die Gründung des regionalen Transformationsnetzwerks zu unterstützen und Ansatzpunkte für eine Regionalanalyse im Bereich Nahetal-Hunsrück zu finden, um daraus wichtige Stabilisierungsfaktoren für die Zukunftsgestaltung der Region ableiten zu können. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse sollen auch anderen Regionen zugute kommen. Das Projekt unter dem Titel „Resiliente Regionen als Zielbestimmung im Transformationsprozess. Eine exemplarische Region in Rheinland-Pfalz (Region Nahetal-Hunsrück)“ startete Ende 2024 und wurde von Uli Latour, Berater bei der Technologieberatungsstelle (TBS) gGmbH in Mainz, geleitet.
Im Projektverlauf wurden zunächst mithilfe eines Methodenmixes, unter anderem einer Literaturrecherche zur Resilienzforschung und der Auswertung einer Vielzahl von relevanten regionalen Daten zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Situation der Region, deren Stärken und Schwächen wie auch deren spezifischen Ressourcen erkundet (Sekundäranalyse). In einem zweiten Schritt erfolgte auf der Basis dieser Analyse eine Online-Befragung von regionalen Expert*innen aus unterschiedlichen Bereichen – Beschäftigte, Interessenvertreter*innen, Geschäftsführer*innen, um Faktoren und Handlungsfelder für eine stabile Zukunftsentwicklung der Region zu identifizieren. Der dritte Schritt, die hierbei gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse mit den regionalen Akteur*innen zu diskutieren und daraus konkrete Maßnahmen für die Zukunftsgestaltung zu entwickeln, soll in einem Nachfolgeprojekt bearbeitet werden.
Das Projekt stützt sich bei der regionalen Bestandsanalyse auf einen Methodenmix quantitativer und qualitativer Daten, um die regionale Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur der Region Nahetal-Hunsrück erfassen zu können. Das Projekt spricht dabei von einem „ganzheitlichen“ Blick auf die Region.
Untersucht wurden unter anderem die folgenden Indikatoren:
- Diversität der Wirtschaft (z. B. Branchenstruktur nach Beschäftigten);
- Innovations- und Forschungsintensität (z. B. Patentintensität);
- Bildung, Qualifizierung, Arbeitsmarkt (z. B. Arbeitslosenquote, Ausbildungsstellen, Fachkräfteengpässe und Vakanzzeiten);
- Bevölkerungsentwicklung und -wanderungen (z. B. Wanderungssaldo);
- Umweltverbrauch (z. B. Energieverbrauch, Energieverfügbarkeit);
- Handlungsfähigkeit öffentlicher Institutionen (z. B. kommunale Verschuldung );
- Beteiligung, Kooperation, Engagement (z. B. Wahlbeteiligung);
- gesellschaftlicher Zusammenhalt (z. B. Kinderarmut).
Impulse für den Transfer
Die Verankerung der Projektinitiatoren – DGB und IG Metall – in dem im Aufbau begriffenen regionalen und zugleich im Transformationsnetzwerk des Landes Rheinland-Pfalz hatte den Vorteil, dass die von dem Projekt ausgehenden analytischen Impulse direkt in die jeweils dort geführten Debatten eingespeist werden konnten.
Von vornherein wurde die regionale Bestandsaufnahme relativ breit angelegt. Die Stärken-Schwächen-Ressourcen-Risiken-(SWOT-)Analyse stützte sich nicht allein auf ökonomische, sondern ebenso auf gesellschaftliche und kulturelle Daten und Fakten. Damit sollte ein ganzheitlicher Blick auf die Region ermöglicht werden, der auch die Potenziale, Widerstandskräfte und (bisher kaum genutzten) Möglichkeiten – unter anderem eine strategisch ausgerichtete Industrie-, Struktur- und Bildungspolitik – der Region Nahetal-Hunsrück thematisiert. Dadurch sollte die Perspektive geöffnet und verhindert werden, dass immer nur altbewährte Wege eingeschlagen werden.
Auf dieser Basis konnten sieben Stabilisierungsfaktoren und darauf fußend zehn Handlungsfelder ausgemacht werden. Werden Maßnahmen in diesen Feldern getroffen und umgesetzt, kann dies zu einer stabilen, resilienten Zukunftsentwicklung beitragen. Die Handlungsfelder sind:
- regionaler Ausbau erneuerbarer Energien,
- Förderung neuer Technologien,
- demografischer Wandel,
- De-Globalisierung, Arbeitsmarktstruktur und Qualifizierung,
- wirtschaftliche Diversifikation,
- Innovationsfähigkeit und technologische Anpassungsfähigkeit,
- Netzwerke und Kooperationen,
- regionale Governance,
- Partizipation.
Um diese detaillierter zu betrachten und gezielt Maßnahmen ergreifen zu können, die den jeweiligen regionalen Gegebenheiten entsprechen, wurden die Handlungsfelder im Wege von Online-Befragungen mit regionalen Expert*innen weiter spezifiziert und mithilfe von Indikatoren operationalisiert. So etwa lässt sich der Stabilitätsfaktor „Netzwerke und Kooperationen“ in folgende Teilaspekte zergliedern:
- Anzahl und Vielfalt der Netzwerke und Akteure; Indikatoren: Anzahl der beteiligten Organisationen (regional und überregional) und Vielfalt der Akteur*innen
- Intensität der Kooperationen; Indikatoren: Anzahl und Häufigkeit der gemeinsamen Projekte sowie Dauer der Kooperationen
- Ergebnisse und Erfolge der Kooperationen; Indikatoren: Erfolgsquote und Anzahl der gemeinsam entwickelten Innovationen oder Patentanmeldungen
- Struktur und Dichte der Netzwerke; Indikatoren: Netzwerkdichte, das heißt: Anteil der tatsächlichen Beziehungen und Clusterbildung innerhalb des Netzwerks
Am Ende entstand ein anspruchsvolles analytisches Gerüst aus Handlungsfeldern, Teilaspekten und Indikatoren, das es regionalen Akteur*innen erleichtern soll, an den Ergebnissen der SWOT-Analyse ausgerichtete, zielgerechte Interventionen zu priorisieren und vorzubereiten. Innerhalb des Projekts erfolgte die praktische Erprobung dieses Instruments durch eine Fokussierung auf zunächst nur drei Themen: Klimawandel, Dekarbonisierung und Fachkräftebedarf.
Die ursprüngliche Absicht, die mit der SWOT-Analyse gewonnenen Erkenntnisse durch eine Kontextanalyse (Erhebung des regionalspezifischen Transformationsanpassungsdrucks) auf der Grundlage von Interviews, Gesprächen und Workshops mit den regionalen Akteur*innen zu spiegeln wie auch eine Akteursanalyse (Wer bringt welche Ideen wie in das Transformationsnetzwerk ein?) zu erbringen, konnte in diesem Projekt nur ansatzweise geleistet werden. Beide Vorhaben sollen deshalb in einem Nachfolgeprojekt vertieft angegangen werden.
In der Gesamtschau ließen sich dennoch wichtige Erkenntnisse gewinnen. Sehr eindringlich rät das Projektteam, grundsätzlich mehr Daten entlang der identifizierten Handlungsfelder in den Regionen zu erfassen. „Bei der Statistik ist noch viel Luft nach oben“, sagt Projektleiter Uli Latour.
Allgemein lässt sich die Region Nahetal-Hunsrück als sehr heterogen beschreiben. Von den vier Landkreisen konnten zwei als eher ländliche und wenig erschlossene Regionen (Landkreise Bad Kreuznach und Birkenfeld), die zwei anderen als städtisch-industrielle identifiziert werden (Ballungsgebiete Mainz und Bingen). Bei den ersten beiden, in denen jeweils der Dienstleistungssektor eine starke Position hat, fallen eine deutliche Anfälligkeit für Konjunkturschwankungen, eine relativ hohe Arbeitslosigkeit und ein stetiger Fachkräftemangel ins Auge. Auch lässt sich ein starkes Stadt-Land-Gefälle bei der digitalen Versorgung feststellen, das sich in den ländlichen Regionen zusätzlich negativ auswirkt. Hier erscheint es deshalb dringlich geboten, einen Zielkatalog mit entsprechenden Gegenmaßnahmen zu formulieren. Strukturpolitisch wären beispielsweise Neuansiedlungen von Unternehmen vonnöten sowie der Ausbau von Bildungsinstitutionen und der Breitbandverkabelung.
Uli Latour, ProjektleiterGerade in puncto Digitalisierung und KI zeigen sich die meisten Befragten unvorbereitet und wenig qualifiziert, dieses Handlungsfeld mitzugestalten.
Bei den beiden anderen – vergleichsweise industriell entwickelteren und eher städtisch geprägten – Regionen treten die Netzwerke und Kooperation vor allem mit wissenschaftlichen Institutionen als starke Standortvorteile hervor. Hier mangelt es aber durchweg – von wenigen Ausnahmen abgesehen – an Innovationen, insbesondere am Ausbau von Innovationszentren, Clustern und langfristigen Kooperationen.
Auch in den Unternehmen sind die Zukunftskonzepte nicht auf der Höhe der Zeit. Zwar werden die Risiken der fortschreitenden Globalisierung gerade im Automobilsektor vielfach erkannt. Aber es gibt kaum Überlegungen bezüglich von Alternativen zum Verbrennermotor und damit zusammenhängenden Produkten sowie hinsichtlich neuer Formen der Mobilität. Ebenfalls augenfällig ist der Umstand, dass der demografische Wandel statistisch gut erfasst, sich aber bisher nur weniger als 20 Prozent der Unternehmen um dieses Thema ernsthaft gekümmert haben. Beispielsweise bedarf es einer langfristigen Personalplanung, um den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen. Gerade hierbei aber zeigt sich ein großer Nachholbedarf.
Auch für die Gewerkschaften gibt es in der Region viel zu tun. So schwindet ihre Verankerung in den Unternehmen und damit geht ihnen tendenziell eine wesentliche Machtressource verloren. Zwar stärkt das Eingebundensein im Transformationsrat Rheinland-Pfalz genauso wie im regionalen Transformationsnetzwerk, das aktuell aufgebaut wird, ihre Position als relevante Akteur*in in der Region. Diese aber werden sie nur festigen können, wenn es ihnen gelingt, die Tarifbindung in den regionalen Unternehmen zu stärken und sich sowohl unter den Beschäftigten als auch den Bürger*innen mehr Rückhalt für ihre Anliegen und Forderungen zu verschaffen.
Uli Latour, ProjektleiterInsgesamt sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass sowohl in den Unternehmen als auch in den Dienstleistungsbereichen in der Region der Transformationsdruck steigt, diese aber bisher keine angemessenen Antworten darauf finden und auf die anstehenden Veränderungen zu wenig vorbereitet sind.
Das hier entwickelte und in der Kooperation mit den regionalen Akteur*innen verfeinerte Analysegerüst hat aus seiner Sicht die Feuerprobe als hilfreiches Handlungsinstrument bestanden – auch wenn es aufgrund seines breiten und voraussetzungsvollen Ansatzes hier nur eingeschränkt erprobt und genutzt werden konnte.
Man darf daher auf das nachfolgende Projekt gespannt sein, das die einzelnen Stabilisierungsfaktoren und Handlungsfelder noch eingehender und differenzierter beleuchten wird. Aber schon jetzt gibt es einen wichtigen Hinweis darauf, wie wichtig es ist, regionale Daten auf breiter Grundlage zu erfassen, um daraus die richtigen Schlüsse für die Erschließung von wichtigen Potenzialen und Kompetenzen zur Zukunftsgestaltung in den Regionen ziehen zu können.
Ansprechpersonen des Projektes
Projektleiter:
Ulrich Latour, TBS gGmbH in Mainz
Kooperationspartnerschaft:
Marc Ferder, DGB Deutscher Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz/Saarland
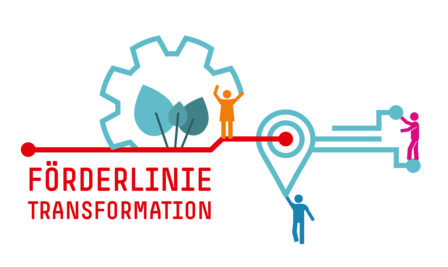
Förderlinie Transformation
Es gibt viele Treiber von Transformationsprozessen: Digitale Transformation, Klimawandel, Energiekrise etc. Folgen sind hoher Veränderungsdruck in Betrieben, Branchen und Regionen und für die dort arbeitenden Menschen. Im Zentrum der Förderlinie steht: Wir bringen Erfahrungswissen und akademisches Wissen gewinnbringend zusammen – betrieblich, regional, lösungsorientiert. Das Ziel ist, mit kurzformatigen Projekten dem hohen Veränderungsdruck in der Arbeitswelt Rechnung zu tragen. Die Veränderungsdynamiken und ihre Anforderungen an Mitbestimmungsprozesse und ihre Akteure sollen wissenschaftlich beraten und begleitet werden.