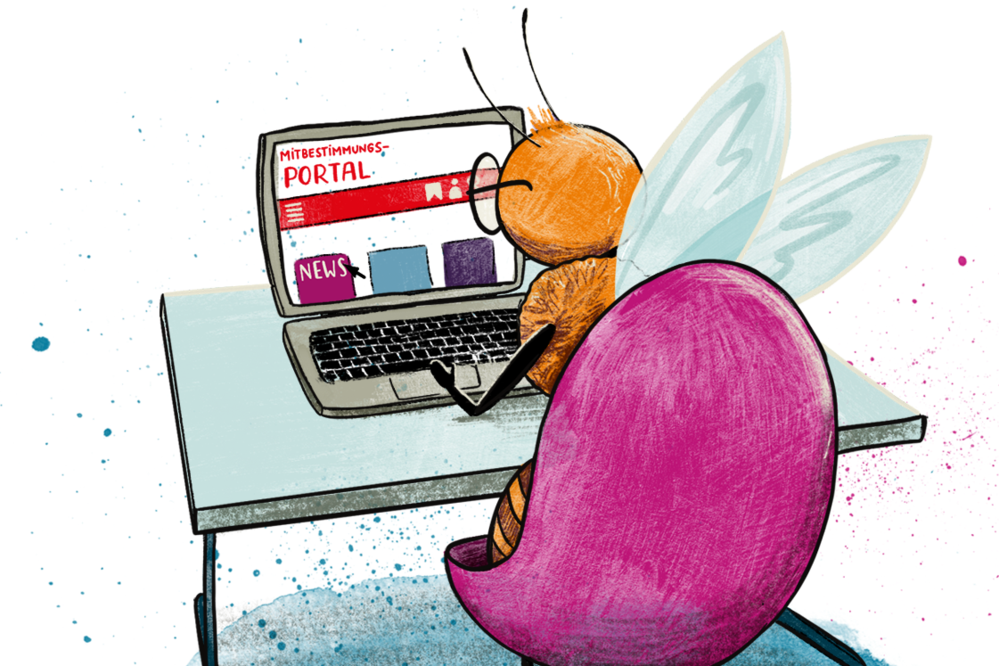Potenziale in der Region entwickeln
Regionalpolitische Strategien gegen Fachkräfteengpässe
Ein Universalrezept gegen den oft behaupteten Fachkräftemangel gibt es nicht. Wer Engpässe beheben will, muss die spezifischen strukturellen Gegebenheiten und Potenziale einer Region genau kennen.
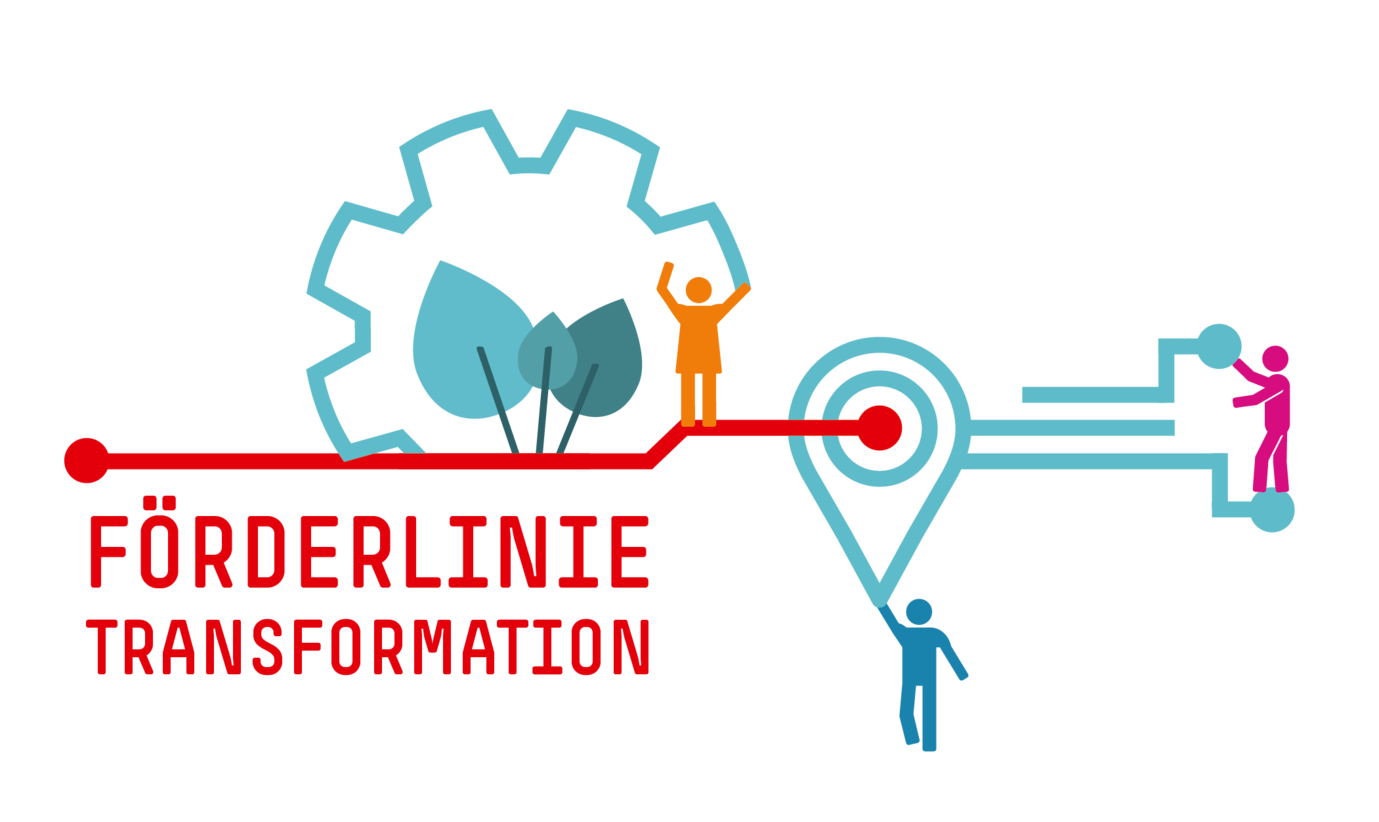
In der Region Weser-Ems lässt sich seit Jahren der Widerspruch zwischen Arbeitskräfteengpässen einerseits und einer hohen Zahl von Arbeitssuchenden, Arbeitslosen, prekär Beschäftigten und (unfreiwillig) Teilzeitbeschäftigten andererseits gut beobachten. In der Praxis gelingt es bisher unzureichend, diesen zu lösen. Und viele Arbeitsmarktexter*innen sind sich sicher, dass die von Arbeitgeberseite immer wieder vorgetragenen universellen Ansätze zur Arbeitskräftesicherung – Verlängerung der Lebensarbeitszeit und Ausdehnung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit – nicht greifen werden.
Hinter diesen Forderungen steckt die Absicht, das Erwerbspotenzial insgesamt auszuweiten, um so Fachkräfteengpässe zu mindern. Zahlen und Fakten der Bundesagentur für Arbeit zeigen aber deutlich, dass es einen allgemeinen Fachkräftemangel nicht gibt, der mit derart universellen Ansätzen bekämpft werden könnte. Vielmehr lassen sich sehr spezifische Fachkräfteengpässe vor allem in bestimmten Regionen, Berufsgruppen und auf verschiedenen Qualifikationsebenen nachweisen. Will man hier gegensteuern, bedarf es eines weitaus differenzierteren Blicks auf die jeweiligen regionalen Gegebenheiten und eines vielschichtigen strategischen Vorgehens von Seiten der regionalen Akteur*innen.
Die DGB-Region Oldenburg-Ostfriesland befasst sich schon lange mit der Frage, wie besonders in der Region Nordwesten (nördliche Weser-Ems-Region) Fachkräfteengpässe zustande kommen, welche Ursachen dabei eine Rolle spielen und wie ihnen beizukommen ist. Daher regte sie im Rahmen der Förderlinie Transformation der Hans-Böckler-Stiftung eine Studie an, die am Beispiel dieser Region die relevanten Faktoren für bestehende Fachkräfteengpässe erkundet und darauf aufbauend eine regionale Strategie entwickelt, die insbesondere darauf zielt, das vorhandene Arbeitskräftepotenzial stärker als bisher zu erschließen und zugleich Gute Arbeit in den regional ansässigen Unternehmen zu verankern. Die Projektstudie wurde von Uwe Kröcher von der Kooperationsstelle Hochschule-Gewerkschaften an der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg geleitet.
Die Autor*innen der Studie stützen sich auf eine umfangreiche Literaturrecherche und die Auswertung von regionalen berufsgruppenbezogenen Arbeitsmarktdaten. Diese wurden mit bundesweiten Daten verglichen. Aus den festgestellten Differenzen zwischen den bundesbezogenen und regionalen Befunden – gefragt wird beispielsweise danach, ob bestimmte Engpässe in der Region stärker ausgeprägt sind als im Bundesgebiet – lassen sich Schlussfolgerungen ziehen, um vorhandene oder absehbare Fachkräfteengpässe einzudämmen.
Bei dieser vergleichenden Bestandsaufnahme orientiert sich die Studie an der Methodik der Fachkräfteengpassanalyse der Bundesanstalt für Arbeit (BA), die für eine Reihe von engpassgefährdeten Berufen sowohl Engpass-Indikatoren als auch unterschiedliche Anforderungsprofile beinhaltet. In der Regionalstudie werden zwölf Berufsgruppen näher betrachtet. Neben den von der BA ausgewiesenen Anforderungsprofilen (Experte, Spezialist/Fachkraft) nimmt die Studie zusätzlich die Gruppe der „Helfer*innen“ in den Blick. Darin liegt ihr innovativer Ansatz, weil dies die Perspektive erweitert. Wenn sich beispielsweise in den Pflegeberufen kein Personalengpass auf der Ebene der Helfer*innen nachweisen lässt, wäre es strategisch geboten, die hier Beschäftigten zu Fachkräften bis hin zu Spezialisten weiter zu qualifizieren, um so Personalengpässe bei den anderen Anforderungsprofilen auffangen zu können.
Ebenfalls in die regionale Bestandsaufnahme eingeflossen sind Ergebnisse aus Expert*inneninterviews und Workshops mit Gewerkschaftsvertreter*innen und mit ausgewählten Arbeitsmarktakteur*innen. Die Studie wurde am 28. Februar 2025 auf einer Veranstaltung der DGB-Region und der Kooperationsstelle Hochschule-Gewerkschaften der Öffentlichkeit vorgestellt.
Zentrales Anliegen
Die Studie geht in ihrem Hauptteil den Ursachen von Arbeitskräfteengpässen in der Region Nordwesten nach. Auf das gesamte Bundesgebiet bezogen spielen hierfür der demografische Wandel, die Erwerbsbeteiligung insbesondere auch von Frauen und Migrant*innen, die branchen- und berufsgruppenspezifische betriebliche Ausbildungsintensität, wie auch das Qualifizierungsniveau und die beruflichen Anforderungsprofile und nicht zuletzt die Attraktivität der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen eine entscheidende Rolle. Das trifft zwar ebenfalls für die nördliche Weser-Ems-Region zu, aber in sehr spezifischer Weise, wie sich in der regionalen Bestandsanalyse zeigte, die auf die zwölf Berufsgruppen mit ihren Risikostufen und den unterschiedlichen Anforderungsniveaus Bezug nimmt.
An diese Bestandsanalyse knüpft die Studie mit einer Potenzialanalyse an, bei der grob abgeschätzt wird, bei welchen Personengruppen, deren Potenzial bislang auf dem Arbeitsmarkt nur ungenügend genutzt wird, die größten Effekte für die Fachkräftesicherung entstehen, wenn sie für eine Erwerbstätigkeit aktiviert würden. Erst auf dieser vielschichtigen Grundlage präsentiert die Studie strategische Ansätze, um Fachkräfteengpässe in der Region Weser-Ems zu vermeiden.
Impulse für den Transfer
Dieser weitgefasste Blick auf die Ursachen von möglichen Fachkräfteengpässen und insbesondere auch auf das Arbeitskräftepotenzial bei der Gruppe der Helfer*innen, aus dem sich viele Fachkräfte rekrutieren lassen, führt weg von pauschalen Forderungen – nach dem Motto: „In Deutschland muss mehr und länger gearbeitet werden“ – und hin zu praktikablen strategischen Maßnahmen, die der Situation in der Region weit stärker gerecht werden. Diese können zudem vor Ort weitaus mehr und gezielter Wirkung entfalten, um Fachkräfteengpässen vorzubeugen.
So kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass der demografische Wandel in der Region kaum als Ursache der Fachkräfteengpässe wirkt, weil diese seit zwölf Jahren bereits eine – gegenüber dem Bundesdurchschnitt überdurchschnittliche – positive Entwicklung der Erwerbspersonenzahl aufweist.
Demgegenüber kann die Erwerbsbeteiligung von Frauen weit eher als Ursache für gegebene Fachkräfteengpässe herangezogen werden. Zwar liegt diese in der Region gegenüber dem Bundesdurchschnitt etwas höher, und doch sind Frauen hier deutlich weniger erwerbstätig als Männer. Zudem macht sich die Erwerbstätigkeit von Frauen vor allem im Zuwachs von Minijobs und Teilzeitarbeit bemerkbar. Verantwortlich dafür kann der im bundesdeutschen Vergleich signifikant geringere Anteil im Bereich Weser-Ems an verfügbaren Kinderbetreuungsmöglichkeiten sein, der viele Frauen daran hindert, vollberufstätig zu sein und sich beruflich weiterzuentwickeln.
Ein bisher in der Region viel zu wenig ausgeschöpftes Arbeitskräftepotenzial sieht die Studie in Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt hier höher als im Bundesdurchschnitt. Doch trotz teils vorhandener Fachqualifikationen sind diese auf dem regionalen Arbeitsmarkt noch immer stark unterrepräsentiert.
Augenfällig ist das seit Jahren bestehende geringe Ausbildungsgebot in der Region Weser-Ems, gerade in sogenannten Engpassberufen (insbesondere Care-Berufen). Daraus könnten sich mit der Zeit hausgemachte Probleme beim Fachkräftenachwuchs ergeben. Hinzu kommen – auch im regionalen Vergleich – die oft unattraktiven Arbeitsbedingungen in einigen Berufsgruppen.
Den Schlüssel für die Fachkräftesicherung in der Region sieht die Studie in der bedarfsgerechten Aktivierung bisher ungenutzter, aber vorhandener Arbeitskräftepotenziale. In ihren Modellannahmen der Potenzialeinschätzung kommt sie zu dem Ergebnis, dass in der Region Nordwest davon ausgegangen werden kann, dass rund 53.000 Personen relativ schnell durch Aktivierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt gewonnen werden und damit in wichtigen Berufsgruppen und bei einzelnen Anforderungsprofilen entstehende Fachkräfteengpässe verhindern könnten.
Uwe Kröcher, ProjektleiterIn der Region müssen wir vor allem zwei Gruppen in den Fokus nehmen, um Arbeitskräfteengpässe zu vermeiden: die große Gruppe der Geringqualifizierten, für die dort ein riesiges Potenzial besteht, aber auch die älteren Beschäftigten. Die Transformation in den Industriebereichen wird gerade die Älteren betreffen, die jedoch bisher noch viel zu wenig als Ressource begriffen werden.
Als strategische Maßnahmen empfiehlt die Studie unter anderem
- die Qualifizierung von gering qualifizierten Personen und Erwerbslosen,
- die Ausweitung der Angebote zur beruflichen Aufstiegsqualifizierung und Weiterbildung (hier insbesondere der Helfer*innen),
- die Stärkung und Verbesserung der beruflichen Erstausbildung,
- die Verbesserung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen sowie den Abbau von prekären Arbeitsverhältnissen,
- die Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Älteren,
- die Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit und
- die Integration migrantischer Erwerbsfähiger in den Arbeitsmarkt.
Ihren Appell, auf diesen Feldern dringend aktiv zu werden, richtet die Studie nicht allein an die Politik und regionalen Akteur*innen. Auch die Unternehmen müssten ihren Verpflichtungen nachkommen und „ihre Anstrengungen zur Verbesserung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen sowie zur Qualifizierung beziehungsweise Weiterbildung von Auszubildenden und Beschäftigten deutlich erhöhen“.
Ansprechpersonen des Projektes
Projektleiter:
Uwe Kröcher, Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, Kooperationsstelle Hochschulen-Gewerkschaften
Weitere Kooperationspartnerschaften:
Dorothee Koch, DGB Oldenburg-Ostfriesland
Wencke Hlynsdóttir, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bezirksverband Weser-Ems
Franke Helmerichs, IG Metall Bezirksleitung Küste / Verwaltungsstelle Emden
Kornelia Haustermann, ver.di Bezirk Weser-Ems
Johanna Waldeck, NGG-Region Oldenburg/Ostfriesland
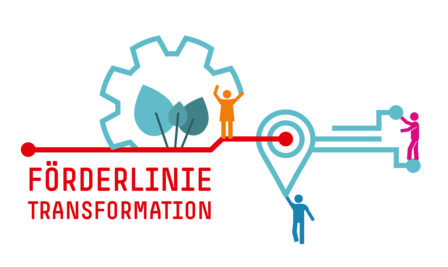
Förderlinie Transformation
Es gibt viele Treiber von Transformationsprozessen: Digitale Transformation, Klimawandel, Energiekrise etc. Folgen sind hoher Veränderungsdruck in Betrieben, Branchen und Regionen und für die dort arbeitenden Menschen. Im Zentrum der Förderlinie steht: Wir bringen Erfahrungswissen und akademisches Wissen gewinnbringend zusammen – betrieblich, regional, lösungsorientiert. Das Ziel ist, mit kurzformatigen Projekten dem hohen Veränderungsdruck in der Arbeitswelt Rechnung zu tragen. Die Veränderungsdynamiken und ihre Anforderungen an Mitbestimmungsprozesse und ihre Akteure sollen wissenschaftlich beraten und begleitet werden.