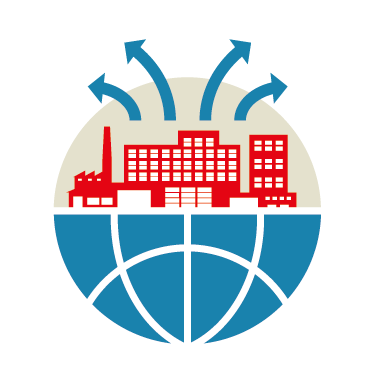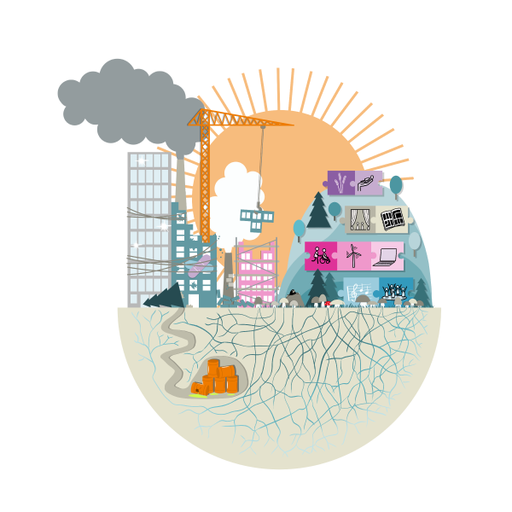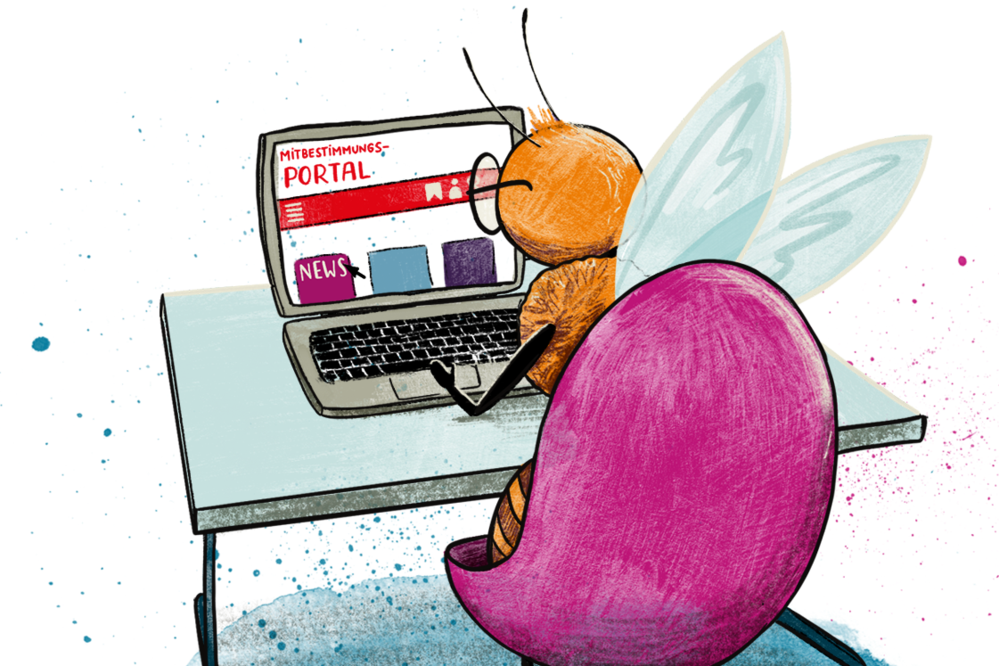Mögliche Entwicklungspfade
Nachhaltigkeit in den Szenarien ‚Unternehmen 2040'

Darum geht's
Wie nachhaltig ist die Unternehmenswelt der Zukunft? Wir beleuchten die vier Szenarien – BENCHMARK, BRICOLAGE, B.I.G. TECH und GEO-ECONOMICS – mit Blick auf Nachhaltigkeit, ergänzt um Leitfragen zur Diskussion.
Szenario Benchmark
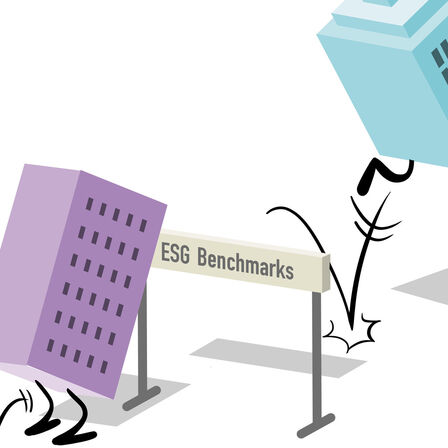
Im Jahr 2040 ist Nachhaltigkeit ein selbstverständlicher Industrie-Standard für den globalen Markt (neben anderen), kein normatives Leitprinzip mehr. Unternehmen müssen CO₂-Ziele, Ressourceneffizienz und ESG-Rankings erfüllen, um überhaupt teilnahmeberechtigt zu sein. Ob die Maßnahmen reale Wirkung entfalten, ist zweitrangig – entscheidend ist die formale Einhaltung der Standards. Gleichzeitig zeigt sich: Viele ökologische Herausforderungen bleiben unterbelichtet, die Umsetzung ist von Kosten- und Wettbewerbsdruck geprägt. Reboundeffekte verringern zudem die Wirksamkeit von Effizienzsteigerungen – denn was günstiger ist, wird auch mehr nachgefragt.
- Investitionen und Industriepolitik: Es wird ordentlich Geld in die Hand genommen – mit einer aktiven staatlichen und EU-weiten Industriepolitik wird die Transformation der deutschen Industrie vorangetrieben. „Green Tech“ soll dabei eine Schlüsselrolle spielen – als wesentlicher „Markenkern“ für die Wiederbelebung der deutschen bzw. europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Ambitionierte ESG-Benchmarks definieren hierfür das Level Playing Field.
- Globale Spielregeln – Märkte sind weltweit geöffnet, Nachhaltigkeitsstandards harmonisiert und international anerkannt. Offiziell herrscht Wettbewerbsneutralität, doch in der Praxis setzen Regionen Regeln unterschiedlich streng um. Ambitionierte ESG-Benchmarks und Taxonomien werden zwar beschlossen, aber angesichts des hohen globalen Wettbewerbsdrucks und erfolgreicher Lobbyarbeit nach und nach aufgeweicht. Entscheidend bleibt die Vergleichbarkeit der Kennzahlen – wer sie liefert, ist dabei.
- Effizienz als Leitbild – Ökologische Innovationen dienen hier vor allem der Ressourceneffizienz, Kostensenkung und Produktivitätssteigerung. Nachhaltigkeit heißt: weniger Energieverbrauch, optimierte Lieferketten, verbesserte Kennzahlen. Gleichzeitig wird Ökoeffizienz durch Mengenwachstum oft kompensiert (Rebound-Effekte), während „grüne Technologien“ selbst enorme Ressourcenverbräuche erzeugen.
- Nachhaltigkeit als Kennzahl – Unternehmen berichten permanent und in Echtzeit über ESG-Scores, CO₂-Reduktionen und Effizienzquoten. Rankings und Ratings bestimmen Investitionen und Marktchancen. Viele ökologische Themen – wie z.B. Biodiversitätsverluste, Bodenerosion, Flächenversiegelung, oder die Emission biologisch nicht abbaubarer Stoffe – geraten ins Hintertreffen, da Klimaneutralität und CO₂-Reduktion im Zentrum stehen.
- Gesellschaftliche Werte – Steigender Konsum und Umsatz bleiben Motor der Wirtschaft. Nachhaltigkeit erscheint im Alltag der Menschen vor allem als Produktlabel oder Qualitätsmerkmal im Export: „effizient, ressourcenschonend, zertifiziert“. Ein grundsätzlicher Wertewandel bleibt aus.
- Politischer Rahmen – Die Politik sorgt für Transparenz, einheitliche Standards und internationale Durchsetzung. Ambitionierte Leitbilder einer sozial-ökologischen Transformation treten allerdings in den Hintergrund, Vorrang hat die Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit. Zudem kommen Rahmenbedingungen wie bezahlbarer Wasserstoff, Ladeinfrastruktur oder Gebäudesanierung langsamer voran als geplant, Fristen werden wiederholt verlängert. Zugleich führt immer aufwendigere Regulierung zu hohen Bürokratiekosten und Zertifizierungsbarrieren.
- Standortdruck – An deutschen Standorten geraten Investitionen in Nachhaltigkeit unter Druck, da hoher Renditeanspruch, preisgetriebener Wettbewerb und der Verlust von Marktanteilen die Handlungsspielräume der Unternehmen einschränken.
- Wie beeinflussen ökonomische Rahmenbedingungen wie Standortwettbewerb, Renditeanforderungen und hohe Regulierungskosten die Umsetzung von Nachhaltigkeit – und inwiefern führt dies dazu, dass Unternehmen Maßnahmen eher formal erfüllen, Kennzahlen priorisieren oder Greenwashing betreiben?
- Was sind die Kernvoraussetzungen für ein faires Level Playing Field, das insbesondere die kleineren und mittleren Unternehmen nicht durch ein Übermaß an Bürokratiekosten und Berichtspflichten überfordert?
- Reichen Effizienzsteigerungen aus, um ökologische Krisen umfassend zu bewältigen – oder führen Rebound-Effekte und die Fokussierung auf Klimaneutralität dazu, dass andere ökologische Probleme wie z.B. Biodiversität oder die Bodenerosion weitgehend ungelöst bleiben?
- Welche sozialen Dimensionen (z. B. Arbeitsstandards, Gerechtigkeit) fallen unter den Tisch, wenn Nachhaltigkeit primär ökologisch und quantitativ gemessen wird?
- Wer setzt die Standards und Benchmarks – Politik, internationale Institutionen oder Konzerne – und wessen Interessen bestimmen sie?
- …
- Wie kann man sicherstellen, dass Nachhaltigkeitsmaßnahmen nicht nur Kennzahlen erfüllen, sondern tatsächlich die Arbeits- und Produktionsbedingungen der Beschäftigten verbessern und positive ökologische Wirkungen entfalten?
- Welche Hebel können Mitbestimmungsakteure nutzen, um die Planung, Einführung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen aktiv mitzugestalten?
- Wie kann man den Arbeitgeber dazu bewegen, Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote bereitzustellen, damit alle Mitarbeitenden effizient an nachhaltigen Prozessen mitwirken können?
- Welche Arbeitsplätze und Gruppen profitieren von Nachhaltigkeitsinitiativen, und wie verhindert werden, dass andere durch Kostendruck, Standortverlagerungen oder steigende Bürokratiebelastungen benachteiligt werden?
- Wie können Beschäftigte vor zusätzlichem Druck und Belastung geschützt werden, die durch Echtzeit-Monitoring, Berichtspflichten und Effizienzziele entstehen?
- Wie kann die Mitbestimmung dazu beitragen, den Zusammenhalt der Belegschaft zu stärken und Polarisierungen z. B. zwischen Stammbelegschaft, Leih- und Werkkräften sowie prekären Beschäftigten zu verhindern, während ökologische Standards umgesetzt werden?
- …
Szenario Bricolage

Im Jahr 2040 wird eine grundlegende Neuausrichtung unserer Wirtschaftsweise als Antwort auf systemische Krisen betrachtet. Aber es gibt keinen Masterplan und es zeigt sich, dass Transformationsprozesse wesentlich turbulenter verlaufen als angenommen. Nachhaltigkeit und Krisen-Resilienz prägen die Erwartungshaltung vielfältiger Stakeholdergruppen. Und immer häufiger zeigt sich: ein hohes Maß an Effizienz mag in ruhigen Zeiten geboten sein, aber für die Bewältigung unvorhergesehener Schocks und abrupter Veränderungen bedarf es Puffer und Reserven. „Bricolage“ – also die Neukombination vorhandener Ressourcen, um neue Lösungen zu kreieren – wird zum Gebot der Stunde. Unternehmen handeln pragmatisch und experimentell, nutzen das Wissen ihrer Beschäftigten und entwickeln regionale, soziale und ökologische Innovationen.
Nicht alle folgen diesem Suchprozess, doch die Art und Weise, wie wir wirtschaften, verändert sich deutlich. Unternehmen, die auf ortsgebundene Geschäftsmodelle und Bedarfe (etwa im Bereich der Erneuerung von Infrastruktur, Energieversorgung oder Mobilität) setzen und regionale Netzwerke entwickelt haben, gelingt der Wandel leichter, als denen, die weiterhin stark vom Export, Skaleneffekten, zentraler Steuerung und hoher Auslastung ihrer Anlagen abhängen, um im Spiel zu bleiben.
- Krisen und gesellschaftlicher Druck – Systemische Krisen wie Klimawandel, Umweltzerstörung, Ressourcenknappheit oder Demokratieprobleme machen ein „Weiter so“ zunehmend unmöglich. Unternehmen müssen wirtschaftliche Aktivitäten mit erheblichen externen Kosten für Umwelt und Gesellschaft überdenken, während gesellschaftlicher Druck, Politik und Gerichte sicherstellen, dass Verantwortung übernommen wird. Hinzu kommt, dass zunehmend auch Unterbrechungen in den hochkomplexen, aber eben auch störanfälligen Wertschöpfungsketten, Wirtschafts- und Finanzkrisen selbst die bisherigen Paradigmen von Wachstum und Effizienz in Frage stellen und zu einer anderen Wirtschaftsweise drängen. Es herrscht das weit verbreitete Gefühl, dass die bestehenden Wirtschafts- und Unternehmensstrukturen zunehmend dysfunktional geworden sind. Ihre Aufrechterhaltung wird immer aufwändiger, der Kreis der Begünstigten wird kleiner und Unternehmensführungen fixieren sich im Tunnelblick der Ertrags- und Umsatzsteigerungsziele – unerreichbar für resiliente Strategien.
- Pragmatische Experimente und kreative Lösungen – Die Krisen eröffnen Raum für neue Ansätze. Belegschaften fordern selbstbewusster Mitsprache bei der Unternehmensentwicklung, bringen ihr Produktions- und Betriebswissen aktiv ein. Die Motivation ist, zu etwas beizutragen, das Zukunftsperspektiven eröffnet. Krisenbedingte Unterbrechungen werden für Übergänge genutzt. Es wird wieder über Konversion gesprochen, darüber dass Arbeit Sinn stiften und einen positiven Mehrwert für Gesellschaft und Region erzeugen muss.
- Breiter Stakeholderfokus und Beteiligung – Unternehmen müssen die Erwartungen vielfältiger Stakeholder stärker berücksichtigen: Konsumenten, Mitarbeitende, lokale Bevölkerungen, NGOs und Behörden. Stakeholder mobilisieren sich, üben Druck aus und fordern Mitsprache.
- Neue Wirtschaftslogiken – Menschen treffen bewusstere Kaufentscheidungen, setzen auf Langlebigkeit und Reparatur und suchen Alternativen zu klassischen Märkten. Sie teilen Ressourcen, kooperieren und entwickeln gemeinschaftlich Lösungen. Wirtschaftskreisläufe werden dadurch regionaler, direkter und gemeinschaftsorientierter, während Netzwerke, Austausch und „Nutzen statt Besitzen“ an Bedeutung gewinnen. Über den Zwischenschritt der „Sharing-Ökonomie“, die häufig noch mit Gewinnstrategien der „Old Economy“ verbunden ist, formieren sich Konturen einer „Caring Ökonomie“, in der die Menschen nicht nur Dinge gemeinsam nutzen, sondern sich auch verstärkt bei deren Her- bzw. Bereitstellung sowie den Unterhalt und nachhaltige Bewirtschaftung einbringen.
- Unternehmenszweck und Organisationsformen – Unternehmen werden zunehmend danach bewertet, welchen Mehrwert sie für Gesellschaft und Umwelt schaffen. Der Unternehmenszweck wird kritisch hinterfragt: Profit und Arbeitsplätze allein reicht nicht mehr aus. Die Größe oder Lebensdauer von Unternehmen ist nicht per se auf Wachstum ausgelegt, sondern wird durch den Unternehmenszweck bestimmt (von Pop-up Unternehmen für kurzfristige Projekte bis hin zu generationenübergreifenden Unternehmungen bspw. in der Daseinsfürsorge und der Infrastruktur).
- Profit-Suffizienz statt -Maximierung – Deutlich mehr Unternehmungen arbeiten ohne hohe Renditeerwartungen. Dadurch können auch solche gesellschaftlich relevanten Projekte umgesetzt und Bedarfe adressiert werden, die nach der bisherigen Logik von Finanzmarktakteuren unattraktiv gewesen wären.
- Globale und regionale Kooperation – Lokale Aktivitäten und Experimente gehen Hand in Hand mit zunehmender globaler Zusammenarbeit, da vernetzte Systeme und weltweite Krisen Unternehmen, Staaten und Menschen zwingen, gemeinsam nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
- Allgemein geht der Trend weg von Konkurrenz und (Preis-)Wettbewerb hin zum kooperativen, bedarfsorientierten Wirtschaften.
- Wie kann trotz dezentraler, experimenteller und lokaler Nachhaltigkeitsinitiativen sichergestellt werden, dass Maßnahmen koordiniert, effizient und wirkungsvoll bleiben und echte Wirkung entfalten?
- Wie verändern sich Unternehmensentscheidungen, wenn Stakeholder stärker in Entscheidungsprozesse einbezogen werden, und welche Folgen hat das für bestehende und künftige Geschäftsmodelle?
- Wie können kapitalmarktabhängige Unternehmen, die kurzfristige Renditeerwartungen erfüllen müssen, dennoch „echte Nachhaltigkeit“ umsetzen?
- Welche Chancen und Risiken ergeben sich, wenn Unternehmen zunehmend auf Profit-Suffizienz statt Renditemaximierung setzen würden, und Strategien primär auf gesellschaftlich sinnvollen Mehrwert ausgerichtet wären?
- Wie wirken sich neue Wirtschaftslogiken – z. B. Ressourcenteilung, regionale Kreisläufe und gemeinschaftliche Lösungen – auf Konsum, Produktion, Kooperation und Unternehmensstrategien aus?
- …
- Wie können Mitbestimmungsakteure Nachhaltigkeitsaktivitäten koordinieren und fördern, sodass sie wirksam, gesellschaftlich relevant und auf übergeordnete Ziele ausgerichtet sind?
- Welche Hebel und Strategien hat die Mitbestimmung, um Unternehmen, die noch nach traditioneller Finanz- oder Renditelogik arbeiten, dazu zu bewegen, gesellschaftlich relevante, partizipative und regionale Nachhaltigkeitsprojekte umzusetzen?
- Wie können Mitbestimmungsakteure das Wissen und Engagement der Beschäftigten nutzen, um kreative, praxisnahe Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen zu entwickeln?
- Wie lässt sich die Einbindung von Stakeholdern und lokalen Gemeinschaften konstruktiv begleiten, um Entscheidungen stärker am gesellschaftlichen Mehrwert auszurichten?
- Wie kann die Mitbestimmung sicherstellen, dass verschiedene Beschäftigtengruppen in Nachhaltigkeitsprozesse eingebunden werden, ohne dass (neue) Polarisierungen entstehen?
- …
Szenario B.I.G. Tech

Im Jahr 2040 gilt Nachhaltigkeit als hegemonialer Maßstab allen Handelns. Planetare Grenzen sind unverhandelbar und werden durch wenige Leitunternehmen sowie ein allgegenwärtiges Monitoring mit Sensorik und KI überwacht. Digitale Plattformen und Ökosysteme bestimmen Regeln, kontrollieren Ressourcenströme und steuern Verhalten. Nachhaltigkeit ist nicht mehr als normatives oder auf der Grundlage gesetzlicher Regulierung zu befolgendes Ziel, sondern algorithmisch verankerte Unausweichlichkeit. KI-basierte Systeme treffen Entscheidungen und stecken den möglichen Handlungsrahmen ab, innerhalb dessen Unternehmen und Menschen agieren können – ermöglicht und getragen wurde diese Entwicklung durch einen engen Schulterschluss zwischen Staaten und global aufgestellten Konzernen.
- Technologische Großlösungen und Monitoring – Sprunginnovationen, Geoengineering, digitale Zwillinge und Echtzeit-Sensorik sollen sicherstellen, dass Wirtschaft und Gesellschaft innerhalb der planetaren Grenzen bleiben. Globale Monitoring-Systeme definieren Standards, kontrollieren Einhaltung und sanktionieren Verstöße.
- Dominanz weniger Leitunternehmen – Rund hundert globale Konzernplattformen prägen Wertschöpfung und Regeln. Sie sind nicht nur Marktteilnehmer, sondern sind die Märkte: Sie setzen Schnittstellen, Nachhaltigkeitsmaßstäbe und Zugangsbedingungen, an denen Staaten, Zulieferer und Konsumenten kaum vorbeikommen.
- Enge Staat-Konzern-Kooperation – Nationale Regulierungen verlieren an Gewicht, da Big Tech Infrastrukturen bereitstellt und zunehmend staatliche Aufgaben übernimmt. Transformation gilt nur im Rahmen eines „Grand Design“ als machbar – getragen von enger Verzahnung öffentlicher und privater Akteure.
- Nachhaltigkeit als hegemoniales Narrativ und als Legitimationsrahmen – Unternehmen sichern ihre „License to Operate and Innovate" (Betriebserlaubnis) maßgeblich über den Nachweis von Nachhaltigkeit. Compliance mit den globalen Standards wird zum Minimum. Investoren, Politik und Gesellschaft erwarten darüber hinaus einen ambitionierten Beitrag zu Transformation und Kreislaufwirtschaft.
- Output-Orientierung und Kontrolle – Nachhaltigkeit wird vor allem über messbare Ergebnisse definiert: Emissionsbudgets, Kreislaufquoten oder Ressourcen-Effizienzindikatoren. Ob diese Kennzahlen tatsächlich ausreichen, um langfristig planetare Grenzen einzuhalten, bleibt ungewiss – gleichwohl gelten sie als entscheidende Referenzpunkte für das Handeln von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
- Technologiegestützte Verhaltensoptimierung – Algorithmen, KI und Nudging lenken Konsum, Mobilität und Arbeitsweisen „unaufdringlich“ in nachhaltige Bahnen. Diese Form der allgegenwärtigen Datenerhebung und -nutzung wird allgemein akzeptiert, da sie Komfort, Sicherheit und passgenaue Angebote schafft – und zugleich das Gefühl vermittelt, aktiv zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beizutragen.
- Wie verändern Algorithmen, KI und Co. das Verhalten von Beschäftigten, Konsumenten und Bürgern, und welche Freiheitsgrade bleiben für eigenverantwortliches Handeln?
- Welche Risiken bestehen, wenn dringende globale Umweltprobleme maßgeblich durch den Einsatz neuer Technologien und ‚Big Fixes‘ wie Geoengineering erreicht werden sollen? Wie lassen sich technologische Lösungen verantwortungsvoll einsetzen?
- Was bedeutet es für demokratische Prozesse, wenn Nachhaltigkeitspolitik zunehmend im Zusammenspiel von Staat, Konzernen und KI „ausgehandelt“ wird?
- Wie können wir sicherstellen, dass eine technologisch gesteuerte Nachhaltigkeit tatsächlich die gewünschten ökologischen und sozialen Effekte erzielt (und es nicht nur „behauptet“)?
- …
- Wie können Mitbestimmungsakteure verhindern, dass technologische Systeme, KI-gesteuerte Prozesse oder Nudging-Mechanismen die Arbeit der Beschäftigten entmenschlichen und ihre Autonomie stark einschränken?
- Wie kann die Mitbestimmung die Qualifizierung und aktive Mitgestaltung der Beschäftigten fördern, wenn Entscheidungsprozesse zunehmend algorithmisch gesteuert werden?
- Wie können Mitbestimmungsakteure ihren Einfluss bewahren und Mitbestimmung ermöglichen, wenn Unternehmensentscheidungen faktisch durch Vorgaben globaler Leitunternehmen und KI-Systeme geprägt werden?
- Was bedeutet es für die "klassischen Mitbestimmungsakteure", wenn Rückmeldungen und Unzufriedenheiten der Beschäftigten automatisch in die Systeme eingespeist und scheinbar direkt gelöst werden, und welche Aufgaben werden dadurch wichtiger? Wie lassen sich gemeinsame Interessen bündeln, wenn sehr viele Beschäftigte remote arbeiten?
- Wie lassen sich Konflikte zwischen den Interessen der global gesteuerten Nachhaltigkeitsziele und den Bedürfnissen der Mitarbeitenden ausbalancieren?
- …
Szenario Geo-Economics

Im Jahr 2040 prägen geopolitische Rivalitäten und nationale Interessen die Weltwirtschaft. Kooperation auf globaler Ebene ist selten und schwierig, das Vertrauen in den internationalen Verhandlungsarenen gering. Nachhaltigkeit verliert ihren Charakter als gemeinsames Fortschrittsprojekt und wird primär unter dem Blickwinkel von Macht, Versorgungssicherheit und Stärkung der eigenen Wirtschaftskraft verfolgt. Dort, wo Ressourcen knapp sind oder Abhängigkeiten vermieden werden müssen, erhält sie strategisches Gewicht – oft weniger aus ökologischen Überzeugungen, sondern als Mittel regionaler bzw. nationaler Selbstbehauptung im Systemkampf der Machtblöcke. Die Sicherung bzw. Verteidigung unserer Lebensweise – die angesichts von Krisen und geopolitischer Konkurrenz immer mehr als gefährdet empfunden wird – gewinnt Vorrang vor den Zielen ökologischer Nachhaltigkeit (wie z.B. die Erreichung einer klimaneutralen Produktion).
- Allgemein: Die Sicherung bzw. Verteidigung unserer Lebensweise – die angesichts von Krisen und geopolitischer Konkurrenz immer mehr als gefährdet empfunden wird – gewinnt Vorrang vor den Zielen ökologischer Nachhaltigkeit (wie z.B. der Erreichung einer klimaneutralen Produktion).
- Nachhaltigkeit als Machtinstrument – Staaten und Unternehmen nutzen Nachhaltigkeit vor allem dort, wo sie zur Sicherung von Energie, Rohstoffen und strategischer Resilienz beiträgt. Sie wird nicht als globaler Wert, sondern als nationale Notwendigkeit verstanden.
- Fragmentierte Regeln und Normen – Globale Klima- und Umweltziele verlieren an Verbindlichkeit. Politische Bündnisse setzen konkurrierende Standards durch, wodurch internationale Wertschöpfungsketten komplexer und konfliktanfälliger werden.
- Kreislaufwirtschaft aus Notwendigkeit – Recycling, Ressourceneffizienz und Substitution werden forciert, um nationale Abhängigkeiten zu verringern. Ökologische Motive treten in den Hintergrund, entscheidend ist die Versorgungssicherheit.
- Staatlich gesteuerte Industriepolitik – Regierungen fördern gezielt „nationale Champions“, subventionieren strategische Branchen und lenken Investitionen in systemrelevante Schlüsseltechnologien. Ziel ist technologische Unabhängigkeit und geopolitische Machtausübung, nicht eine koordinierte Nachhaltigkeitsstrategie.
- Decoupling / Regionalisierte Wertschöpfung – Globale Lieferketten werden zurückgebaut; On- und Nearshoring schaffen neue regionale Produktionsnetzwerke, um geopolitische Risiken zu minimieren. Kürzere Transportwege und regionale Kreisläufe fördern dabei indirekt auch Nachhaltigkeit, stehen aber nicht im Zentrum der Strategie.
- Wohlstandsverluste und Konsumreduktion – Krisen, geopolitische Spannungen, Ressourcenkonkurrenz und wirtschaftliche Umstrukturierungen führen zu einem Rückgang des Wohlstands. Dies verringert den Konsum, was den globalen ökologischen Fußabdruck senkt – jedoch als indirekter Effekt und nicht als Folge einer bewussten Transformation hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften.
- Arbeitswelt unter politischem Einfluss – Staatliche Vorgaben prägen zunehmend Beschäftigung, Qualifizierung und Unternehmensstrategien, sodass Mitbestimmung, Arbeitnehmerinteressen und die soziale Dimension von Nachhaltigkeit oft in den Hintergrund treten.
- Was bedeutet dieses Szenario für unsere derzeitigen Transformationspfade und insbesondere Unternehmen, die früh in „saubere Technologien“ investiert haben, wenn die Regulierung dies gar nicht mehr goutiert und eher „Last Man Standing“ Strategien belohnt werden?
- Wie können Unternehmen dennoch nachhaltige Praktiken fördern, obwohl Nachhaltigkeit primär lediglich als Mittel zur Sicherung knapper Ressourcen und nationaler Unabhängigkeit verstanden wird?
- Wie können Unternehmen ihre Organisation, Lieferketten und Investitionen resilient gestalten, wenn geopolitische Spannungen internationale Kooperationen erschweren und Risiken für Produktion, Lieferketten und Absatzmärkte steigen?
- Konkret: Was bedeutet dieses Szenario für exportorientierte (-abhängige?) Branchen und Unternehmen? Was bedeutet das für die derzeitige Ressourcenbasis? Wie würde sich die Substituierung von kritischen Ressourcen und Vorprodukten mit Blick auf die ökologische Nachhaltigkeit auswirken – würde die Produktion dadurch „sauberer“ oder „schmutziger“?
- Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich durch On-/Nearshoring und regionalisierte Produktionsnetzwerke, sowohl für die Wettbewerbsfähigkeit als auch für ökologische Fußabdrücke und Ressourceneffizienz?
- Grundsätzlich: Wie können die mit der Nachhaltigkeitsfrage verbundenen Gefangenendilemmata aufgelöst werden? Wie kann die für eine globale Transformation notwendige Kooperations- und Vertrauenskultur (wieder) hergestellt werden?
- …
- Wie können Mitbestimmungsakteure (präventiv) agieren, wenn zentrale Arbeitnehmerrechte und -leistungen – etwa Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung, Kündigungsschutz, Arbeitszeiten und Urlaub – unter Druck geraten, weil staatliche und unternehmerische Ressourcen in geopolitisch angespannten Zeiten neu priorisiert werden?
- Wie kann die Mitbestimmung Einfluss auf Unternehmensentscheidungen nehmen, wenn Politik/Akteure zunehmend Einfluss auf Unternehmensentscheidungen nehmen und Strategien stark durch nationale Interessen, staatliche Industriepolitik und geopolitische Blocklogiken geprägt sind?
- Wie können Mitbestimmungsakteure negative Effekte von Wohlstandsverlusten und reduziertem Konsum auf Mitarbeitende abfedern, etwa psychologische Belastungen, Unsicherheit oder reduzierte Kaufkraft, und welche direkten Unterstützungsformen sind dafür besonders geeignet?
- Wie kann einer zunehmenden Polarisierung innerhalb der Belegschaft entgegentreten werden und wie lassen sich Zusammenhalt und gemeinsame Ziele fördern?
- …