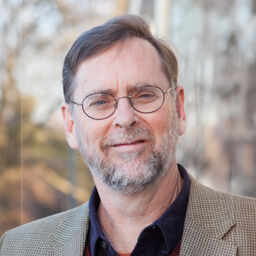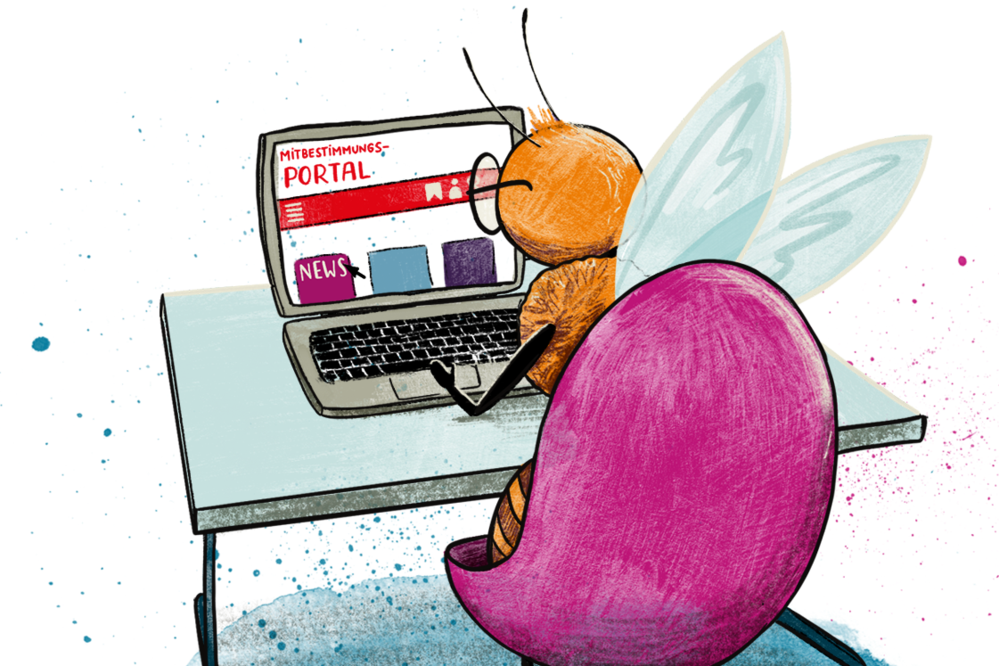Kolumne
KI verändert die Arbeitswelt in den USA rasant
Die Auswirkungen von KI werden immer schneller spürbar, während sich Donald Trump vom Kritiker zum Großinvestor in Sachen KI (und Kryptowährungen) wandelt.

In den letzten zwei Jahren ist Künstliche Intelligenz (KI) langsam, aber sicher in alle Lebensbereiche vorgedrungen, einschließlich der Arbeitswelt. Im November 2023 berichtete ich in meinem Artikel für das Mitbestimmungsportal „US-Gewerkschaften streiken wegen Folgen von KI und neuer Technologien“, dass verschiedene US-amerikanische Gewerkschaften, wie die United Auto Workers, Screen Actors Guild (Drehbuchautoren) und andere, sich allmählich gegen KI-Technologien wehren, die ihre Branchen auf den Kopf zu stellen und ihre Arbeitsplätze zu vernichten drohen.
Zwei Jahre später dringt KI weiter unaufhaltsam in alle Bereiche unseres Lebens vor. Und jetzt wird diese Entwicklung auch noch teilweise von Präsident Trump beflügelt, der KI (und Kryptowährungen) anfangs skeptisch gegenüberstand, sich aber inzwischen zum großen Unterstützer beider gewandelt hat (zu den Gründen später mehr). Während es 2023 im Anschluss an eine Pandemie, die Homeoffice und mobiles Arbeiten normal werden ließ, noch um die Erprobung von KI ging, wurde 2024 schon ihre Einführung vorangetrieben. Expert*innen zufolge wird 2025 nun das Jahr, in dem die Unternehmen den Weg tiefgreifenderer Veränderungen in der Arbeitswelt auf Basis einer noch disruptiveren KI einschlagen werden.
Schnelle Verbreitung von KI in der Arbeitswelt
Eine aktuelle, vierteljährlich vom angesehenen Meinungsforschungsinstitut Gallup durchgeführte Arbeitskräfteerhebung hat festgestellt, dass der Anteil der Beschäftigten in den USA, die sagten, im letzten Jahr bei ihrer Arbeit zumindest gelegentlich KI genutzt zu haben, sich gegenüber der Erhebung von 2023 nahezu verdoppelt hat: von 21% auf 40%. Der Anteil der US-amerikanischen Beschäftigten, die beruflich häufig KI nutzen, hat sich ebenfalls auf 19% verdoppelt. Der Anteil derjenigen, die täglich unter Einsatz von KI arbeiten, hat sich auf 8% verdoppelt.
Diese KI-Welle ist besonders in Angestelltenberufen spürbar: Über ein Viertel dieser Gruppe berichtet, häufig KI zu nutzen, was ebenfalls eine Verdoppelung im Vergleich zu 2024 darstellt. Es ist nicht überraschend, dass die Branchen mit der höchsten KI-Nutzung der Technologiesektor (50%), professionelle Dienstleistungen (34%) und der Finanzsektor (32%) sind. Im Vergleich dazu ist die häufige KI-Nutzung durch Produktions- und kundennahe Mitarbeiter*innen in den letzten zwei Jahren weitgehend unverändert geblieben.
In den nächsten zehn Jahren könnten weltweit 300 Millionen Arbeitsplätze durch KI-Automatisierung wegfallen, was 25% des globalen Arbeitsmarkts betreffen würde.
Wie schnell wird sich KI weiterverbreiten? Die Vielzahl von Prognosen verschiedener Herkunft – darunter auch Akteure aus dem Silicon Valley mit ureigenen Interessen – erschweren eine verlässliche Aussage. Goldman Sachs, eine der weltweit größten Investitionsbanken, prognostiziert, dass in den nächsten zehn Jahren weltweit 300 Millionen Arbeitsplätze durch KI-Automatisierung wegfallen könnten, was 25% des globalen Arbeitsmarkts betreffen würde. Nach Schätzungen des Weltwirtschaftsforums, das eine Zunahme und Investitionen in KI befürwortet, wird der Anteil der Arbeiten, die hauptsächlich von KI-Maschinen ausgeführt werden, in fünf Jahren von knapp über einem Fünftel auf über ein Drittel steigen. Der viel diskutierte Bericht „Scenario AI 2027“ zitiert Expert*innen, die eine schnellen Umsetzung in den nächsten zehn Jahren und Auswirkungen erwarten, die „die der Industriellen Revolution übersteigen“ werden.
Steigert KI die Arbeitsproduktivität? Viele Arbeitnehmer*innen meinen: „Nein!“
Die Einführung von KI am Arbeitsplatz liegt in dem Versuch begründet, die Produktivität zu steigern. Es ist jedoch bekanntermaßen schwierig, Produktivität zu messen oder zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden, und die Datenlage ist bisher nicht eindeutig. Von vielen Arbeitnehmer*innen selbst hört man hingegen, dass ihnen die KI mehr statt weniger Arbeit bereitet und zu Burnout führt.
Eine aktuelle Studie von CSIRO, einem der führenden staatlichen Forschungszentren in Australien, beleuchtet die tägliche Nutzung von Microsoft 365 Copilot durch 300 Beschäftigte. Während die Mehrheit von ihnen berichtete, dass sich die Nutzung positiv auf ihre Produktivität auswirkt, war eine doch große Minderheit (30%) anderer Meinung. Laut Studie erhöht KI die Arbeitsproduktivität insbesondere bei „geringqualifizierten” Aufgaben wie dem Erstellen von Besprechungsnotizen und im Kundenservice oder bei Arbeiten, die von geringer qualifizierten Berufseinsteiger*innen oder Mitarbeitenden mit schwachen Sprachkenntnissen ausgeführt werden. Eine Studie von 2023 unter 750 Berater*innen der Boston Consulting Group ergab, dass sie ihre Aufgaben mithilfe generativer KI um 18% schneller erledigen. Eine Forschungssynthese aus dem Jahr 2024 zitiert Studien, die eine Verbesserung der organisatorischen Produktivität durch den Einsatz von KI in Deutschland, Italien und Taiwan belegen.
Eine andere Untersuchung von 300.000 US-amerikanischen Firmen fand jedoch keine signifikante Korrelation zwischen der Einführung von KI und der Produktivität – im Gegensatz zu anderen Technologien wie Robotik und Cloud Computing, wo sie feststellbar war. Andere Studien leiten hingegen besorgniserregende Schlüsse aus den Aussagen der befragten Arbeitnehmer*innen ab.
Vierzig Prozent der Beschäftigten meinen, dass ihr Unternehmen bei KI zu viel von ihnen erwartet und so dazu beiträgt, dass sie sich ausgebrannt fühlen.
In einer Umfrage der Online-Arbeitsvermittlungsplattform Upwork unter 2.500 Fachkräften antworteten 77% der Befragten, dass generative KI ihre Produktivität mindere und ihre Arbeitsbelastung erhöhe. Dem Bericht zufolge fühlen sich viele Arbeitnehmer*innen „von der zusätzlichen Arbeitsbelastung und damit verbundenen Komplexität überfordert“, während 71% der befragten Vollzeit-Arbeitnehmer*innen von Burnout sprachen und 65% angaben, mit den Produktivitätsanforderungen ihrer Arbeit- bzw. Auftraggeber zu kämpfen.
Rund 47% der befragten Arbeitnehmer*innen sagten, dass sie nicht darin geschult sind, die Tools zur Steigerung ihrer eigenen Produktivität zu nutzen und sie keine klaren Vorgaben und Informationen zur richtigen Verwendung hätten. Die Befragten berichteten, dass sie mehr Zeit aufwenden müssen, um KI-generierte Inhalte zu prüfen oder zu überarbeiten (39%) sowie den Umgang mit den KI-Tools zu erlernen (23%) und nun mehr Arbeit erledigen müssen (21%). Im Ergebnis stimmen unter den Befragten, die ihrer Aussage nach KI nutzen, nur 16% vollumfänglich zu, dass die von ihrem Unternehmen bereitgestellten KI-Tools sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Vierzig Prozent der Beschäftigten meinen, dass ihr Unternehmen bei KI zu viel von ihnen erwartet und so dazu beiträgt, dass sie sich ausgebrannt fühlen.
Unterdessen beschäftigen sich die US-amerikanischen Arbeitnehmer*innen mit der Frage, was KI für ihre berufliche Zukunft bedeutet. In einer Umfrage von Pew Research sagte rund die Hälfte der befragten Arbeitnehmer*innen (52%), dass sie die möglichen Auswirkungen von KI am Arbeitsplatz beunruhigen, und 32% glauben, dass sich ihre Beschäftigungsmöglichkeiten dadurch verschlechtern. Nur 6% der Befragten meinen, dass der Einsatz von KI am Arbeitsplatz mehr Beschäftigungschancen für sie eröffnet. Geringverdiener*innen und Beschäftigte mit mittlerem Einkommen sind tendenziell eher der Meinung, dass KI am Arbeitsplatz ihre Beschäftigungsmöglichkeiten schmälern wird, als Besserverdienende.
Ihre Sorgen kommen nicht von ungefähr. Mark Benioff ist CEO von Salesforce, einem der weltweit größten Softwareunternehmen für Geschäftsanwendungen, die der Steigerung der Produktivität dienen (sollen). Er berichtet, dass bereits zwischen 30% und 50% der gesamten Arbeit in seinem Unternehmen von KI übernommen wird, und meint, dieser Anteil werde weiter steigen. Microsoft kündigte kürzlich zwei Entlassungswellen an, die 16.000 Mitarbeitende betreffen und Berichten zufolge teilweise KI-basierten Effizienzsteigerungen geschuldet sind. Meta/Facebook und Amazon haben davor gewarnt, dass KI zu einem Personalabbau im eigenen Unternehmen führen wird, wobei einige Arbeitsmarktexpert*innen sich fragen, ob Mark Zuckerberg und Amazon die zunehmende Verbreitung von KI als Vorwand nutzen, um bereits geplante Entlassungen durchzuführen.
Und ganz aktuell hat eine neue Studie von Erik Brynjolfsson von der Stanford University herausgefunden, dass junge Beschäftigte zwischen 22 und 25 Jahren in Berufen mit „hoher KI-Exposition”, wie Softwareentwickler*innen und Kundendienstmitarbeiter*innen, seit der Einführung von ChatGPT einen Rückgang der Beschäftigung um 13 Prozent erlebt haben. Diese Studie bestätigt die Ergebnisse anderer Untersuchungen, beispielsweise der New York Federal Reserve, wonach sich die Beschäftigungsmöglichkeiten für Hochschulabsolvent*innen „deutlich verschlechtert” haben, was durchaus auf eine bevorstehende Disruption durch KI hindeuten könnte.
Probleme in der Arbeitswelt durch KI: Datenschutzverletzungen, Big Brother und Diskriminierung
KI verursacht den Arbeitnehmer*innen heute schon Probleme und mit ihrer weiteren Verbreitung am Arbeitsplatz nehmen die Herausforderungen zu. Einige sind darauf zurückzuführen, dass KI zu schnell und ohne feste Strategien oder interne Regeln eingeführt wird. Dies resultiert in Datenschutzverletzungen und Sicherheitsrisiken bei der Datenverarbeitung. Die KI-gestützte Erfassung und Nutzung großer Mengen personenbezogener Mitarbeiterdaten erhöht die Gefahr der künftigen missbräuchlichen Überwachung von Arbeitnehmer*innen.
Viele sehen sich mit der beängstigenden Aussicht auf einen „total kontrollierten” Panoptikum-Arbeitsplatz konfrontiert.
Bereits jetzt sehen wir den voranschreitenden Einsatz von KI am Arbeitsplatz, der von Technologien zur Überwachung einzelner Arbeitnehmer*innen bis zu robotergestützten Zeiterfassungsgeräten reicht, die die erfassten Arbeitszeiten zu niedrig angeben. Der berüchtigte Fall von Amazon, wo die Mitarbeitenden überwacht und ihre Produktivität mithilfe von KI sekundengenau bewertet wird, ist gut dokumentiert. Weniger bekannt ist dies hingegen von Berufen wie den Kassierer*innen beim Einzelhändler Kroger, UPS-Fahrer*innen und vielen anderen, die sich zunehmend mit der beklemmender Aussicht auf einen „völliger Kontrolle“ unterstehenden und an ein Panopticon erinnernden Arbeitsplatz konfrontiert sehen. KI-gestützte Apps und Bots informieren den Vorgesetzten im Falle von „Problemen”, da sie riesige Datenmengen zur Leistungsbeurteilung erfassen. Womöglich wissen die Arbeitnehmer*innen nicht einmal, welche Daten der Arbeitgeber sammelt. Aber in dem Maße, wie sich diese Technologien zur Mitarbeiterüberwachung weiterentwickeln, droht die Entstehung eines Klimas der Angst. Die Arbeitnehmer*innen müssen fürchten, unter ständiger Beobachtung zu stehen, ohne die Kriterien zu kennen, die einen „guten” oder erfolgreichen Arbeitnehmer kennzeichnen.
Abgesehen von diesen Ängsten vor Orwellscher Überwachung sind KI-Systeme anfällig für Cyberangriffe, die sensible Daten womöglich zu illegalen Zwecken abgreifen könnten. Außerdem nehmen ethische Bedenken hinsichtlich Urheberrechtsverletzungen und Haftungsfragen zu, da sich die KI im Internet wahllos aus beliebigen Quellen bedient.
Die neuesten alarmierenden Maßnahmen der Trump-Regierung
Die aktuelle KI-Welle wird vom Weißen Haus unterstützt. Jahrelang zeigten Donald Trump und seine Söhne Don Jr. und Eric keinerlei Interesse und äußerten sich sogar ablehnend und kritisch zu KI sowie Kryptowährungen. Aber in Trumps Welt kann das Barometer schnell umschlagen und sich seine Meinungen unerwartet ändern, sodass sich KI plötzlich als gute Chance für die Geschäfte der Familie präsentiert.
Als eine seiner ersten Amtshandlungen zu Beginn seiner zweiten Amtszeit hat Präsident Trump den „Präsidialerlass zur sicheren und vertrauenswürdigen Entwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz“ der Biden-Regierung aufgehoben. Außerdem ordnete Trump die Überarbeitung einer weiteren Präsidialverordnung aus der Amtszeit von Joe Biden an, die als „National Security Memo” bekannt ist und die Verwendung von KI in Bereichen regelt, die für die nationale Sicherheit von Belang sind. Nur wenige Tage später erließ Trump seinen eigenen Präsidialerlass zu KI, der die Bundesbehörden anweist, bei der Personaleinstellung und in anderen Bereichen „moderne Technologien” zu integrieren. Viele befürchten, dass dieser Erlass zu einer unfairen Nutzung von KI aufgrund von Verzerrungen bei der Verwendung von Algorithmen führen wird. Es gibt bereits Fälle, in denen die inhärenten Verzerrungen, die sich aus den zum Anlernen der Algorithmen verwendeten Daten ergeben und gesellschaftliche Vorurteile widerspiegeln, zu diskriminierenden Ergebnissen bei Einstellungen, Beförderungen und anderen Unternehmensprozessen sowie der Kreditvergabe, der Verhängung von Haftstrafen und weiteren sensiblen Entscheidungen geführt haben.
Kürzlich schrieb das für Arbeitnehmerrechte zuständige National Institute of Workers' Rights, dass die Trump-Regierung mit der Förderung der KI einen beispiellosen Angriff auf die Durchsetzung der Bürger- und Arbeitnehmerrechte gestartet habe und KI als Mittel nutze, unerwünschte Bewerber*innen auszusortieren. Da Schätzungen zufolge 98,4% der Fortune-500-Unternehmen KI in ihren Einstellungsverfahren nutzen, ist das potenzielle Ausmaß der möglichen Diskriminierung enorm.
CBS berichtet, dass sich das Nettovermögen der Familie Trump dank ihrer verschiedenen Investitionen um 2,9 Milliarden Dollar erhöht hat.
Woher kommt das plötzliche Interesse von Trump und seinen Söhnen und warum wird dieses Thema nun priorisiert? Die Trump-Familie möchte KI nicht nur für parteipolitische Vorteile ausschlachten, sondern hat außerdem entdeckt, dass sie ein „Goldesel“ ist. Ihnen ist aufgegangen, wie sie mit Investitionen in KI und auch mit Kryptowährungen viel Geld verdienen können – in Milliardenhöhe. Laut Forbes stehen die Investitionen der Familie Trump in KI-Infrastruktur und Kryptowährungen für eine allgemeine Neuausrichtung in ihrer Geschäftsstrategie, die sich über die traditionellen Geschäftsbereiche wie Immobilien und Hotels hinaus in neue Technologiebereiche vorwagt.
Nur wenige Wochen nachdem Trump die Vorschriften der Biden-Regierung aufgeweicht hatte, investierten seine Söhne Don Jr. und Eric in ein neues Unternehmen namens American Data Centers Inc., das zum Ziel hat, eine leistungsstarke Rechnerinfrastruktur aufzubauen, um KI, Cloud Computing und Krypto-Mining zu unterstützen. Mit diesen Investitionen kann die Familie Trump von dem staatlich geförderten Wachstum profitieren, bei dem KI-Unternehmen einschließlich des Ausbaus von Rechenzentren gezielt subventioniert werden. CBS berichtet, dass sich das Nettovermögen der Familie Trump dank ihrer verschiedenen Investitionen um 2,9 Milliarden Dollar erhöht hat, was Berichten zufolge nun fast 40% des persönlichen Nettovermögens von Trump ausmacht.
Die Silicon-Valley-Credos „Move fast and break things“ („Handle schnell und brich mit Etabliertem“) und „Do it now and apologize later“ („Jetzt handeln, später entschuldigen“) haben – anfangs unter Federführung der DOGE-Regierungsbehörde für Regierungseffizienz von Tesla-CEO Elon Musk – das Weiße Haus erobert. Mit seinen jüngsten Maßnahmen bricht Trump mit den letzten 50 Jahren republikanischer Wirtschaftsdoktrin. So verlangt das Weiße Haus zum Beispiel von KI-Infrastrukturunternehmen wie Intel und NVIDIA eine Beteiligung von 10-15% im Gegenzug für staatliche Investitionszuschüsse, die ironischerweise ausgerechnet durch das Chip-Gesetz der Biden-Regierung (das Trump zuvor kritisiert hatte) finanziert werden. Damit betreibt Trump de facto eine teilweise Verstaatlichung der Wirtschaft und verfolgt ein eindeutiges Ziel: alles zu beschleunigen, was die rasante Entwicklung und Verbreitung von KI vorantreiben kann.
Niemand rechnet damit, dass die Trump-Administration diese Branchen maßgeblich regulieren wird.
Unternehmen, die auf der Linie des Weißen Hauses liegen, wie beispielsweise die Firmen, die Trumps Söhne unterstützen, werden bei der künftigen Vergabe staatlicher Aufträge für den Ausbau von KI und Rechenzentren bevorzugt behandelt. Gleichzeitig hat Trump Schutzmaßnahmen vor Auswüchsen von KI abgebaut und Arbeitnehmer*innen sowie Bürger*innen realen Risiken ausgesetzt.
Angesichts des Laissez-faire-Klimas gegenüber KI sowie Kryptowährungen und Silicon-Valley-Unternehmen im Allgemeinen sowie dem enormen finanziellen Interesse des Präsidenten und seiner Familie an einer möglichst breiten Nutzung von KI wird diese auch weiter mit hohem Tempo in die Arbeitswelt vordringen. Niemand rechnet damit, dass die Trump-Administration diese Branchen maßgeblich regulieren wird.
In einer Zeit, in der die neuen Regeln für die Nutzung von KI am Arbeitsplatz und in der Wirtschaft für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre festgelegt werden, ziehen sich die Laissez-faire-Regulierungsbehörden noch weiter zurück. Mit weniger Regulierung und Leitplanken zum Schutz von Arbeitnehmer*innen und Gesellschaft einerseits und einem von sich eingenommenen Präsidenten, der die Grenzen zwischen Bundesregierung und Privatwirtschaft niederwalzt, befinden sich die Vereinigten Staaten in gefährlichem Fahrwasser.
Englische Fassung der Kolumne
-
Kolumne
Im globalen Wettlauf um KI-Infrastruktur steht viel auf dem Spiel
-
Kolumne
KI verändert die Arbeitswelt in den USA rasant
-
Kolumne
Trump und Musk nehmen Beschäftigte und ihre Rechte unter Beschuss
-
Kolumne
Unterstützung für die Mitbestimmung aus ungewohnter Ecke – von konservativen US-Republikanern
-
Kolumne
Können die EU und USA ihre Arbeitnehmerschaft im 21. Jahrhundert schützen?
-
Kolumne
Tech-Unternehmen rüsten sich mit massiven Entlassungen für ihre KI-Zukunft
-
Kolumne
US-Gewerkschaften streiken wegen Folgen von KI und neuer Technologien
-
Kolumne
Das Kartellrecht wird in den USA (endlich) wieder durchgesetzt
-
Kolumne
Digitale Überwachung von Beschäftigten nimmt zu
-
Kolumne
Zu schön, um wahr zu sein?
-
Kolumne
Hilfe zur Selbsthilfe für „Gig Workers“
-
Kolumne
Arbeitnehmer*innen weltweit … schmeißen hin?
-
Kolumne
Werden die US-Gewerkschaften den Uber-Fahrern und ‚Gigworkers‘ beistehen?
-
Kolumne
Zaghafte Ansätze gewerkschaftlicher Organisation im „Big-Tech-Paradies“
-
Kolumne
Wird US-Präsident Biden die Arbeitnehmenden und Gewerkschaften stärken?
-
Kolumne
Werden Beschäftigte im Homeoffice ausspioniert?
-
Kolumne
Arbeit(en) nach Corona
-
Kolumne
Amazon-Beschäftigte wehren sich
-
Kolumne
Ein Schlag gegen Scheinselbständigkeit und Gig Economy
-
Kolumne
Arbeitnehmergenossenschaften für das digitale Zeitalter
-
Kolumne
Mitbestimmung rückt in den USA ins Rampenlicht
-
Kolumne
Prekäre Arbeit nach "Uber Art"
-
Kolumne
Der „dezentrale Arbeitnehmer“
-
Kolumne
Trump attackiert US-Arbeitnehmer und Gewerkschaften
-
Kolumne
Wer wird für „gute Arbeitsplätze“ kämpfen?